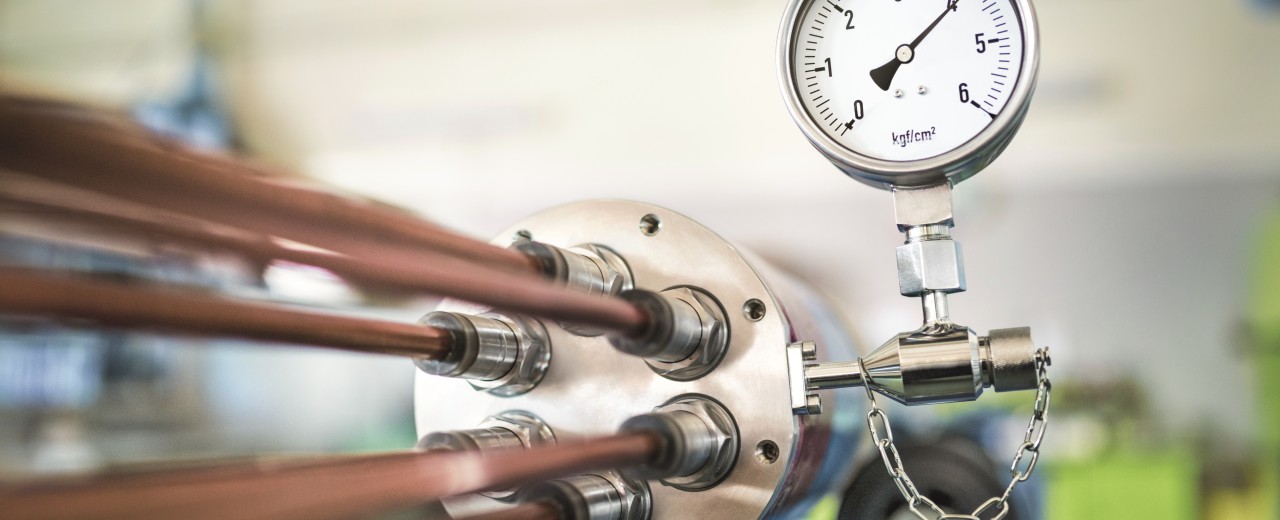
KfW Research
Mittelstand und Wettbewerbsfähigkeit
Das aktuelle KfW-Mittelstandspanel zum Download
Aktuelle Auswertungen des KfW-Klimabarometers zeigen, dass im Jahr 2022 4,3 % oder rund 160.000 der privaten Unternehmen in Deutschland in die Erzeugung und Speicherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien investiert haben. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. In Folge der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gestiegenen Preise für fossile Energieträger wurden Investitionen in erneuerbare Energien attraktiver.
Über die Hälfte der deutschen Unternehmen (54 %) nutzten bereits Strom aus erneuerbaren Energien. Nur jedes zehnte Unternehmen setzte dagegen Wärme aus erneuerbaren Energien ein. In größeren Unternehmen sind sowohl Strom als auch Wärme aus erneuerbaren Energien weiter verbreitet als in kleineren. Die Wärmebereitstellung in Industrie und Gewerbe basiert nach wie vor zum Großteil auf fossilen Energieträgern. Deshalb gilt es jetzt auch die Dekarbonisierung der industriellen Prozesswärmeversorgung stärker in den Fokus zu rücken.
Weitere Publikationen zum Thema Klimaneutralität
Digitalisierungsaktivitäten trotzen der Konjunktur
Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Schub auf die Digitalisierung im Mittelstand hält an. Die zentralen Ergebnisse des aktuellen KfW-Digitalisierungsberichts Mittelstand sind:
- Der Anteil mittelständischer Unternehmen mit abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben steigt auf 33 %.
- Die Digitalisierungsausgaben sind mit 29,3 Mrd. EUR weiterhin auf hohem Niveau.
- Die Digitalisierungsaktivitäten sind stark auf große Mittelständler konzentriert.
KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2023(PDF, 1 MB, barrierefrei)
Weitere Informationen in unserem Dossier Digitalisierung
Fokus Volkswirtschaft
In Deutschland hat sich Klimaschutz längst als relevanter Wirtschaftsfaktor etabliert. Dies spiegeln auch aktuelle Befragungsergebnisse aus dem KfW-Klimabarometer wider, wonach bereits heute 30 % der Unternehmen in Deutschland – dies sind rund 1,1 Mio. Unternehmen – Waren oder Dienstleistungen anbieten, die zum Klimaschutz beitragen. Dabei haben 12 % oder rund 450.000 Unternehmen ihr Angebot sogar vorrangig auf Klimaschutzgüter ausgerichtet. Besonders aktiv sind Unternehmen aus der Baubranche sowie dem Maschinen- und Fahrzeugbau und der Elektroindustrie.
Ein Blick auf die mittelfristigen Geschäftsplanungen offenbart zudem, dass das Angebot an Produkten und Dienstleistungen mit Klimaschutzbezug weiter an Bedeutung gewinnen wird. Knapp ein Viertel der Unternehmen (22 %) planen in den kommenden drei Jahren ihr Angebot dahingehend auszuweiten.
Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen findet endlich wieder den Weg nach oben und macht im März einen ordentlichen Sprung von 4,9 Zählern auf -16,8 Saldenpunkte. Zwar ist die Stimmung damit noch immer ungewöhnlich schlecht, die Richtung stimmt aber in allen Bereichen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2024(PDF, 185 KB, barrierefrei)
Studien und Materialien
Die Studie untersucht, welche Gruppen von mittelständischen Unternehmen stark von der Corona-Pandemie betroffen waren, und wie schnell sie sich von den Auswirkungen der Pandemie erholt haben. Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass auch als leistungsstark geltende Unternehmen häufig Umsatzeinbußen erlitten haben. Sie erholten sich jedoch schneller als andere Unternehmen davon. Dies gilt insbesondere für Unternehmen mit guter Bonität sowie innovative sowie bei der Digitalisierung aktive Unternehmen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Mittelstands wurde durch die Pandemie kaum beeinträchtigt.
Kreditmarkt hat Tiefpunkt durchschritten
Das Geschäft mit Unternehmenskrediten schrumpft deutlich. Im dritten Quartal 2023 fielen die von KfW Research berechneten Kreditneuzusagen bereits um 15,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Kreditrückgang im vierten Quartal verlangsamte sich bereits mit -12,5 %. Der deutliche Einbruch wird durch den volumenstarken Vorjahreszeitraum inmitten der Energiekrise getrieben. Der Tiefpunkt am Kreditmarkt ist damit vorerst überstanden.
Die Investitionsausgaben der Unternehmen haben die Kreditvergabe kaum noch gestützt. Die leicht nachlassenden Kreditzinsen und die abgeschwächte Nachfragezurückhaltung hingegen beeinflusste die Kreditentwicklung positiv.
Eine Trendwende auf dem Kreditmarkt setzt jedoch voraus, dass sich die Konjunktur belebt und sich die Zinssenkungserwartungen verfestigen. Aufgrund der pessimistischen Wirtschaftsaussichten, rechnen wir im ersten Halbjahr 2024 noch mit einer geringen Schrumpfung des Kreditgeschäfts. Danach dürfe das Kreditgeschäft wieder zulegen.
Die Frauenquote an der Spitze mittelständischer Unternehmen ist zuletzt wieder deutlich auf 15,8 % gesunken. Im Jahr 2023 wurden 602.000 kleine und mittlere Unternehmen von einer Frau geführt, ein Minus von rund 155.000 Unternehmen. Nach wie vor ist die zurückhaltende Gründungstätigkeit bei Frauen ein Grund für den geringen Chefinnenanteil. Die aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt zudem erstmals den Anteil weiblicher Führungskräfte an sämtlichen Managementpositionen in den mittelständischen Unternehmen. Danach sind im Jahr 2023 rund ein Viertel aller Führungspositionen weiblich besetzt (26 %). Gemessen am Frauenanteil an allen Erwerbstätigen (47 %) sind Frauen bei Führungspositionen in Mittelstand damit unterrepräsentiert. Chefinnen-Unternehmen haben dabei einen fast 5-mal höheren Anteil weiblicher Führungskräfte als männergeführte KMU. Um die Frauenquote an der Spitze mittelständischer Unternehmen zu erhöhen braucht es mehr Gründerinnen.
Zur Sonderseite Frauen
Die Stimmung unter den kleinen und mittleren Unternehmen stagniert im Februar auf niedrigem Niveau. Sowohl die Lageurteile als auch die Erwartungen sind fast unverändert schlecht. Nur im Dienstleistungsbereich und unter den Einzelhandelsunternehmen hellt sich das Geschäftsklima wieder etwas auf. Außerdem sinken die Absatzpreiserwartungen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2024(PDF, 142 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Konjunktur
Fokus Volkswirtschaft
Bei der Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität spielt das Finanzsystem eine wichtige Rolle. Denn für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist eine entsprechende Mobilisierung von Kapital notwendig. Daher wird auch in der Kreditvergabe Nachhaltigkeitsinformationen eine zunehmende Bedeutung zukommen. In diesem Prozess befinden sich bislang vor allem die Kreditinstitute und ihre größeren Unternehmenskunden, für den Mittelstand in der Breite sind Nachhaltigkeitsinformationsanfragen noch relativ selten. Die Ergebnisse einer Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel im Herbst 2023 zeigen: im vergangenen Jahr wurde nur bei rund jedem sechsten mittelständischen Unternehmen in Kreditverhandlungen (16 %) das Thema Nachhaltigkeit adressiert. Dies betraf insbesondere größere Mittelständler – hier lag der Anteil bei 45 %. Der Informationsbedarf zum Thema Nachhaltigkeit dürfte zukünftig jedoch weiter zunehmen und auch kleine und mittlere Unternehmen einbeziehen.
Innovationstätigkeit im Mittelstand tritt auf der Stelle
Die Innovationsaktivitäten im Mittelstand profitieren nicht vom Abklingen der Corona-Pandemie. Die zentralen Untersuchungsergebnisse des aktuellen KfW-Innovationsberichts Mittelstand sind:
- Zuletzt 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen mit innovativen Produkten und Prozessen.
- Innovationsausgaben konstant bei 34 Mrd. EUR, inflationsbereinigt damit leichter Rückgang.
- Innovationsausgaben im Mittelstand sind stark auf große Mittelständler konzentriert.
KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2023(PDF, 1 MB, barrierefrei)
Weitere Informationen und Veröffentlichungen auf der Themenseite Innovationen
Fokus Volkswirtschaft
Die Besetzung offener Stellen stellt mittelständische Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Insbesondere innovativen Unternehmen fällt die Rekrutierung schwerer. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel liegen die Gründe hierfür in den höheren Anforderungen an die Kompetenzen der Bewerber. Innovative Unternehmen sehen ihre Anforderungen vor allem hinsichtlich der mathematisch-statistischen Fähigkeiten, der Sozial- sowie der Digitalkompetenzen häufiger als nicht erfüllt als andere Unternehmen. Diese höheren Anforderungen sind darauf zurückzuführen, dass innovative Unternehmen neuere Technologien nutzen sowie bei der Arbeits- und Unternehmensorganisation moderner aufgestellt sind. Auch aus den Erfordernissen ihrer Innovationsprozesse resultieren erhöhte Anforderungen bei den genannten Kompetenzen.
Weitere Informationen und Veröffentlichungen auf der Themenseite Innovationen
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die Rückzugsplanungen bei den Inhaberinnen und Inhabern der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland nehmen zuletzt Fahrt auf, wie das neue Nachfolge-Monitoring Mittelstand zeigt: Rund 125.000 mittelständische Unternehmen sollen danach im Zuge einer Nachfolge übergeben werden – und das im Durchschnitt jährlich bis Ende 2027. Dem weiter starken Wunsch einer Nachfolgelösung innerhalb der Familie steht schwindendes Interesse möglicher Nachfolgekandidaten gegenüber. Insgesamt gibt es jährlich nur rund halb so viele Übernahmegründungen wie Nachfolgeplaner im Mittelstand. Der wachsende Engpass erhöht die Anforderungen an die Senior-Generation. Daher ist es sehr erfreulich, dass der Planungsstand der derzeitigen Inhabenden zuletzt so gut war wie nie zuvor. Die Zahl der bereits geregelten Nachfolgen erreicht einen Höchststand. Für fast drei von vier der kurzfristig angestrebten Übergaben bis Ende 2024 haben sich bereits Nachfolger oder Nachfolgerinnen gefunden.
Weitere Informationen auf der Themenseite Generationenwechsel im deutschen Mittelstand
Die Stimmung unter den Mittelständlern trübt sich im Januar 2024 weiter ein, nachdem sie schon im Dezember nachgegeben hatte. Niedriger als jetzt war das Geschäftsklima zuletzt während des Lockdowns im Frühjahr 2020. Wir sehen darin vor allem einen Ausdruck erheblicher Verunsicherung, sodass positive Nachrichten für die Konjunktur nur noch schwer durchdringen. Dennoch gibt es sie. Ein solcher Silberstreif ist die absehbare Erholung der privaten Kaufkraft: Bei nachlassendem Inflationsdruck und steigenden Reallöhnen dürften zentrale Belastungsfaktoren im Verlauf dieses Jahres abnehmen und eine vor allem vom Konsum getragene Erholung einsetzen. Von daher dürfte Deutschland 2024 zumindest wieder leicht wachsen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2024(PDF, 255 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Konjunktur
Fokus Volkswirtschaft
Die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit bleibt in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Nur 23 % der 18–67-Jährigen hätten sich 2022 unabhängig von ihrer aktuellen persönlichen Situation für die berufliche Selbstständigkeit entschieden. Ohne aktuelle und ehemalige Selbstständige sind es sogar nur 17 % der Personen im erwerbsfähigen Alter, allerdings können 30 % es sich vorstellen, sich einmal selbstständig zu machen. Die häufigsten Hemmnisse für die Gründungstätigkeit sind Sicherheitsbedürfnisse, Bürokratie und Kapitalmangel.
Weitere Informationen und Veröffentlichungen in unserem Dossier Existenzgründungen
Fokus Volkswirtschaft
Datenschutz, Steuer- und Arbeitsrecht sowie lange Verwaltungsverfahren sind die mit Blick auf Bürokratie am häufigsten genannten Innovationshemmnisse. Die konkrete Bremswirkung ist jedoch kaum zu beziffern. Um eine unverhältnismäßig starke Belastung der Innovationsaktivitäten durch Bürokratie zu vermeiden, ist es erforderlich, bürokratische Regelungen darauf zu prüfen, ob die intendierten Schutzwirkungen in einem sinnvollen Verhältnis zur innovationshemmenden Wirkung stehen. Bürokratieabbau ist daher ein kleinteiliger Prozess, der Expertenwissen und einen langen Atem erfordert. Eine Möglichkeit, um das Entstehen neuer bürokratischer Belastungen zu verhindern, ist die Umsetzung einer konsequenten Innovationsprüfung neuer rechtlicher Regelungen. Auch die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen und der Schnittstelle zu Unternehmen ist ein Weg, die Belastung der Unternehmen durch Bürokratie zu verringern.
Weitere Informationen und Veröffentlichungen zum Thema Innovationen
Der Kreditzugang bleibt für deutsche Unternehmen beschwerlich. Zwar ist die von den Unternehmen wahrgenommene Kredithürde im vierten Quartal leicht von ihrem Höchstwert zurückgegangen. Trotzdem bewerteten unter den kleinen und mittleren Unternehmen über ein Viertel, nämlich 28,8 % das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als restriktiv.
Auch das Kreditinteresse der Unternehmen ist weiterhin schwach. Trotz der stark gestiegenen Kreditzinsen im vierten Quartal, hat die Kreditnachfrage keine zusätzlichen Einbußen erfahren, sondern blieb auf niedrigem Niveau stabil. Die restriktive Geldpolitik und die schwachen Konjunkturaussichten sind die Hauptbelastungsfaktoren für das Kreditgeschäft.
Das mittelständische Geschäftsklima erleidet am Jahresende einen Rückschlag. Während im Herbst noch eine Erholungstendenz vorherrschte, sinkt das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Dezember um 3,1 Zähler auf -19,1 Saldenpunkte. Vor allem die Skepsis beim Blick nach vorne hat wieder zugenommen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2023(PDF, 249 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Konjunktur
Fokus Volkswirtschaft
Die Energiekrise hat eine Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland ausgelöst und die Sorge um eine zunehmende Deindustrialisierung verstärkt. Die Auslandsinvestitionen des deutschen Mittelstands deuten jedoch auf eine unverändert geringe Tendenz zur Verlagerung von Unternehmensaktivitäten ins Ausland hin: So haben im Zeitraum 2019–2022 gerade einmal 1,7 % aller kleinen und mittleren Unternehmen im Ausland investiert. Vor allem aber planen auch in den kommenden Jahren nicht mehr als 3,8 % – und damit in etwa genauso viele Unternehmen wie vor der Corona-Pandemie – grenzüberschreitend zu investieren. Die Erschließung neuer Absatzmärkte – auch für Klimaschutztechnologien und grüne Produkte – steht dabei klar im Vordergrund. Wichtigste Zielregion mittelständischer Auslandsinvestitionen bleibt Europa. Ungeachtet möglicher Standortverlagerungen zeichnen sich deutliche Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ab, die es dringend zu adressieren gilt.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Deutschland im globalen Umfeld
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht, welche Maßnahmen mittelständische Unternehmen ergreifen, um ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Zentrales Ergebnis ist, dass die Unternehmen dabei sehr zielgerichtet und entsprechend ihren Bedürfnissen vorgehen. So favorisieren vor allem große, innovative und bei der Digitalisierung aktive Mittelständler Investitionen in das Knowhow. Auf allgemeine personalpolitische Maßnahmen setzen dagegen häufiger Unternehmen mit älteren Beschäftigten sowie Unternehmen, die keine Hochschulabsolventen beschäftigten.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Unternehmen fahren Kreditaufnahme zurück
Das Geschäft mit Unternehmenskrediten verliert weiter an Schwung. Im zweiten Quartal fielen die von KfW Research berechneten Kreditneuzusagen bereits um 3,8 % relativ zum Vorjahr, im dritten Quartal dürfte sich der Rückgang sogar auf rund 15 % beschleunigt haben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im vergangenen Sommer die Energiekrise und Lieferkettenstörungen die Kreditvergabe auf Rekordwerte getrieben hatten.
Die geldpolitische Straffung hat die Kreditkosten rapide steigen lassen. Unternehmen üben daher bei der Aufnahme neuer Darlehen Zurückhaltung. Einer noch stärkeren Schrumpfung haben die trotz überwiegend schlechter Stimmung deutlich gestiegenen Investitionsausgaben entgegengewirkt.
Auch wenn der Tiefpunkt des Kreditwachstums bereits hinter uns liegen dürfte, ist mit einem Andauern der Flaute zu rechnen. Die Gemengelage aus schwachem Wachstum, hohen Zinsen und trüben Geschäftserwartungen spricht für eine schwache Entwicklung der Kreditvergabe bis in das neue Jahr hinein.
KfW-Kreditmarktausblick Dezember 2023(PDF, 125 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Durch den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ergeben sich neue Anforderungen an die beruflichen Fähigkeiten der Beschäftigten (z.B. hinsichtlich spezifischem wirtschaftlichem, technischem, oder digitalem Know-how). Ergebnisse aus einer Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel zeigen, dass es über der Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen (59 %) an einer oder mehrerer dieser Kompetenzen mangelt. Bei der Beschaffung der fehlenden Qualifikationen setzen Unternehmen vermehrt auf kurze Weiterbildungsmaßnahmen - mit häufig begrenzter Qualifikationswirkung. Um einer Koexistenz von Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, ist eine Ausweitung der Weiterbildungsaktivitäten notwendig. Hierbei können sich finanzielle Fördermaßnahmen, gezielte Informations- bzw. Beratungsangebote oder eine zunehmende Formalisierung des Weiterbildungsangebotes (z.B. durch Festlegung von Mindeststandards) als hilfreich erweisen.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die geldpolitische Wende, die im Sommer 2022 eingeleitet wurde, hat das Finanzierungsumfeld der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland spürbar verändert. Eine Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel vom September 2023 zeigt: rund sieben von zehn Unternehmen, die im laufenden Jahr Kreditverhandlungen mit Banken oder Sparkassen geführt haben, bewerteten den ihnen angebotenen Zinssatz als zu hoch. Erst mit deutlichem Abstand folgen andere Probleme.
Dementsprechend gedämpft ist aktuell auch die grundsätzliche Neigung von KMU, Bankkredite zur Finanzierung von Investitionen in Betracht zu ziehen. Im September 2023 gaben rund 42 % der KMU an, dass sie gegenwärtig einen Bankkredit zur Investitionsfinanzierung nutzen würden - im Herbst 2017 waren es noch 66 %. Fast die Hälfte derjenigen Unternehmen, die sich aktuell gegen eine Kreditfinanzierung aussprechen, gaben als Grund die hohen Zinsen an (45 %). Zum Vergleich: im September 2017 lag dieser Anteil nur bei 8 %.
Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland steigt im November um genau einen Zähler auf -15,9 Saldenpunkte. Damit verdichten sich die Hinweise, dass der konjunkturelle Talboden durchschritten ist. Noch beruht der Stimmungsaufschwung aber nur auf weniger pessimistischen Geschäftserwartungen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer November 2023(PDF, 129 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Konjunktur
Trotz Energiekrise: Anstieg der Klimaschutzinvestitionen deutscher Unternehmen im Jahr 2022 um real 18 %
Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten infolge der Energiekrise sind die Klimaschutzinvestitionen der Unternehmen in Deutschland im Jahr 2022 um real 18 % angestiegen – auf 72 Mrd. EUR. Das zeigt das KfW-Klimabarometer 2023. Neben den stark gestiegenen Energiepreisen für fossile Energieträger, die Investitionen in die Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien attraktiver gemacht haben, dürften auch Vorzieheffekte aufgrund der sich abzeichnenden Fremdkapitalverteuerung und steigender Investitionsgüterpreise vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 den Klimaschutzinvestitionen einen Schub verliehen haben. Das Wachstumsplus der Klimaschutzinvestitionen im vergangenen Jahr ging dabei auf das Konto größerer Unternehmen und Mittelständler ab 10 Beschäftigte. Die Ergebnisse zeigen auch, dass fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen Klimaschutz zumindest teilweise in ihrer Strategie verankert haben. Bei der Operationalisierung besteht allerdings noch Luft nach oben. Rund 70 % der Unternehmen haben bislang keine konkreten Pläne zur Treibhausgasminderung entwickelt, dies betrifft vor allem kleine und mittlere Unternehmen.
KfW-Klimabarometer 2023(PDF, 565 KB, barrierefrei)
Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf der Themenseite KfW-Klimabarometer
Nach fünf Rückgängen in Folge bekommt das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen im Oktober endlich die Kurve. Es steigt um 2,1 Zähler auf -17,1 Saldenpunkte. Der Talboden der Unternehmensstimmung ist wohl durchschritten.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Oktober 2023(PDF, 184 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Konjunktur
Belastungsfähigkeit des Mittelstands wird auf die Probe gestellt: bislang nur leichte Blessuren, aber erhöhte Anspannung ist spürbar
Erneut wurde im zurückliegenden Jahr die Resilienz der mittelständischen Unternehmen auf die Probe gestellt. Doch trotz aller Belastungsfaktoren sind die Blessuren überschaubar geblieben. Die Investitionen und die Umsätze haben zugelegt, auch preisbereinigt standen Zuwächse zu Buche. Die Gewinnmargen wurden dennoch belastet, trotz teilweiser Kostenweitergabe. Die Kapitalstruktur der Unternehmen zeigt sich aber insgesamt robust. Die Liquiditätslage ist komfortabel, die Schuldentragfähigkeit ist weiter gegeben Auch die Eigenkapitalausstattung blieb trotz Energiekrise stabil. Aktuell blicken die Unternehmen aber mit Skepsis auf ihre Geschäftsentwicklung: Die Konjunkturaussichten sind gedämpft, die Investitions- wie auch die weiteren Umsatzaussichten sind eingetrübt und der Kreditzugang wird schwieriger. Das zeigt das KfW-Mittelstandspanel 2023 und gibt ein umfassendes Lagebild zur gegenwärtigen Situation im Herbst 2023 als auch zur Entwicklung der Unternehmen im abgelaufenen Jahr.
KfW-Mittelstandspanel 2023(PDF, 1 MB, barrierefrei)
Das Geschäftsklima der Mittelständler hat sich zum Sommerausklang kaum noch verschlechtert, die Geschäftserwartungen allein klettern sogar erstmals wieder leicht nach oben. Gleichzeitig offenbart der Blick in die Segmente ein differenziertes Bild: Bei den Mittelständlern verbessert sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe und dem Großhandel und bei den Großunternehmen sogar über alle Hauptwirtschaftsbereiche hinweg. Der konjunkturelle Talboden könnte erreicht sein.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer September 2023(PDF, 206 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Der deutsche Mittelstand ist im Bereich Klimaschutz schon aktiv: mehr als die Hälfte der KMU plant in den kommenden drei bis fünf Jahren fest mit Klimaschutzinvestitionen oder diskutiert darüber. Gemessen am immensen Investitionsbedarf, der zur Erreichung des Klimaneutralitätszieles notwendig ist, besteht jedoch noch Steigerungsnotwendigkeit. Ergebnisse aus einer Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel zeigen, dass die KMU bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzinvestitionen mit einer Vielzahl an Hemmnissen konfrontiert sind, vor allem in den Bereichen Wirtschaftlichkeit und Finanzierung. Um diese Hemmnisse anzugehen bedarf es eines breiten Mix an Instrumenten. Darunter fallen insbesondere die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, damit sich die Unternehmen überhaupt erst auf den angestrebten Klimaneutralitätspfad begeben, sowie Ansatz an den finanziellen Hemmnissen z.B. in der Unterstützung neuartiger Klimaschutztechnologien.
Vielfältige Hemmnisse bremsen Klimaschutzinvestitionen im Mittelstand(PDF, 279 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Das vergangene Jahr war von turbulenten Preisentwicklungen auf den Energiemärkten gekennzeichnet. Zuletzt waren die Sorgen vieler mittelständischer Unternehmen vor einer finanziellen Überforderung durch hohe Energiepreise jedoch gesunken. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem umfangreiche Maßnahmen zur Verringerung des eigenen Energieverbrauchs oder zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die massiven Anstrengungen der Unternehmen haben sich ausgezahlt: Im Mai 2023 war der Energiekostenanteil am Umsatz niedriger als vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Für viele mittelständische Unternehmen sind weitere Energieeinsparungen aber mit großen Herausforderungen verbunden. Das trifft vor allem auf kleinere sowie auf energieintensive Unternehmen zu. Es ist daher ratsam mit Hilfe geeigneter Maßnahmen, wie Beratung oder finanzieller Förderung, die Unternehmen bei der Identifizierung und Umsetzung weiterer Energieeinsparmaßnahmen zu unterstützen.
Die bereits schlechte Stimmung unter den Mittelständlern verschlechtert sich weiter: Ihr Geschäftsklima sinkt zum vierten Mal in Folge und fällt im August auf den niedrigsten Stand seit den akuten Energiesorgen im Oktober letzten Jahres. Wie schon im Vormonat geben die Geschäftslageurteile stärker nach als die Geschäftserwartungen. In den Großunternehmen trübt die Stimmung allerdings noch deutlicher ein als im Mittelstand. Alles in allem wird sich die deutsche Wirtschaft wohl lediglich in Trippelschritten aus dem breiten Konjunkturtal herausarbeiten können.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer August 2023(PDF, 150 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Leasing ist ein im Mittelstand etabliertes Beschaffungsinstrument. Dies zeigen erstmalig repräsentative Zahlen des KfW-Mittelstandspanels zur Leasingnutzung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Zuletzt hat mehr als jeder fünfte Mittelständler in Deutschland Leasing zur Anschaffung von Anlagegütern in Anspruch genommen.
Die Nutzung von Leasing im Mittelstand wird aber vor allem vom Pkw-Leasing dominiert. Rund 80 % der KMU, die in den Jahren 2021 oder 2022 Leasingverträge abgeschlossen haben, taten dies, um Pkw anzuschaffen.
Auch ein direkter Vergleich zur klassischen Investition (Kauf) verdeutlicht die weiterhin nachrangige Bedeutung von Leasing bei der Beschaffung von Anlagegütern. Nichtsdestotrotz hat Leasing das Potenzial einen wichtigen Beitrag bei der dualen Transformation der Wirtschaft zu leisten. Denn für Investitionsprojekte in den Bereichen Digitalisierung und Klimaneutralität bietet sich Leasing als geeignete (Finanzierungs-) Alternative an.
Volkswirtschaft Kompakt
Unternehmen, die Klimaschutz (teilweise) in ihrer Unternehmensstrategie verankert haben, rechnen mit einem Anteil von 66 % häufiger mit Problemen bei der Stellenbesetzung als Unternehmen, die Klimaschutz nicht in ihrer Strategie berücksichtigen (59 %). Das zeigen aktuelle Ergebnisse aus dem KfW-Mittelstandspanel. Die Unterschiede in den Stellenbesetzungsproblemen sind häufig auf fehlende digitale Fähigkeiten und Qualifikationen der Bewerbenden zurückzuführen. Damit mangelnde (Digital-)Kompetenzen nicht zum zentralen Hindernis der Dekarbonisierung werden, sollten Aus- und Weiterbildungsangebote auf die Qualifikationsanforderungen grüner Unternehmen zugeschnitten werden. Insgesamt gilt es zudem relevante Schnittstellenkompetenzen zu identifizieren und vermehrt in das Bildungsangebot zu integrieren, da Klimaschutz im unternehmerischen Handeln an vielen Stellen Berührungspunkte zu weiteren Themengebieten aufweist.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Fokus Volkswirtschaft
Deutsche Unternehmen befinden sich bei der Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotte auf einem guten Weg: Ergebnisse des KfW-Klimabarometers zeigen, dass der Anteil elektrisch betriebener Pkw zuletzt bei rund 15 % über alle Unternehmensklassen hinweg lag und damit deutlich höher ist als bei Privathaushalten. Unternehmen neigen aber auch dazu, häufiger Plug-in-Hybride und große, energieintensive Fahrzeuge einsetzen. Hier könnte eine Reformierung der Dienstwagenbesteuerung Anreize für mehr Emissionseffizienz schaffen.
Im Bereich der Nutzfahrzeuge sind E-Fahrzeuge mit einem Anteil von rund 2 % bisher kaum verbreitet. Gründe dafür sind eine spätere technische Verfügbarkeit, höhere Anschaffungskosten und eine noch kaum vorhandene Hochleistungsladeinfrastruktur. Dementsprechend dürften hier Anreize für weitere Technologieentwicklungen und ein Ausbau der Ladeinfrastruktur einem schnellen Markthochlauf klimafreundlicher Antriebsarten Vorschub leisten.
Der Unternehmensfuhrpark – ein wichtiger Hebel für die Klimaneutralität(PDF, 249 KB, barrierefrei)
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Klimaneutralität
Nach den Rekordzuwächsen im vergangenen Jahr erreichte das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft deutscher Banken mit Firmenkunden im ersten Quartal nur noch knapp den Vorjahreswert. Auch für das zweite Quartal deuten die bereits verfügbare Daten auf Stagnation hin. Die Banken tendieren bei der Kreditvergabe weiter zur Vorsicht, aber ein Ende der Straffungen der Kreditzugangskriterien scheint in Sichtweite zu kommen.
Die Kreditnachfrage entwickelt sich indes verhalten. Krisenbedingte Liquiditätsbedarfe haben sich weitgehend zurückgebildet. Hohe Zinsen und schwache Konjunkturaussichten dämpfen den Appetit auf Finanzierungen zu Investitionszwecken.
Für das dritte Quartal rechnen wir mit einem Rückgang des Neugeschäfts um 10 % ggü. dem außerordentlich starken Vorjahresquartal. Falls sich die Investitionstätigkeit der Unternehmen jedoch schwächer zeigt als von uns erwartet, könnte die Schrumpfung der Kreditvergabe noch deutlicher ausfallen.
KfW-Kreditmarktausblick August 2023(PDF, 157 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen haben KMU im vergangenen Jahre sorgenvoll auf ihre Kapitalstruktur blicken lassen. Doch wie schon zuvor hat der Mittelstand auch in dieser Krise Flexibilität bewiesen. Umfangreiche Anpassungsmaßnahmen haben die Unternehmen befähigt, die gestiegenen Energiekosten besser zu schultern.
Dies hat auch den Druck auf die Kapitalstruktur der KMU reduziert, wie eine aktuelle Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels vom März 2023 zeigt. Wieder deutlich optimistischer blicken die KMU derzeit auf die Entwicklung ihrer Eigenkapitalquote im laufenden Geschäftsjahr. Fast drei Viertel der Unternehmen erwarten, dass sie ihre Eigenkapitalausstattung im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren konstant halten oder sogar verbessern können.
Vieles deutet also darauf hin, dass der Mittelstand mit Blick auf seine Eigenkapitalausstattung die Energiekrise mit überschaubaren Blessuren überstanden hat.
Fokus Volkswirtschaft
Die demografische Alterung setzt Unternehmen bei Nachfolgen gleich doppelt unter Druck: Auf der einen Seite steigt die Zahl an nachfolgebereiten Inhaberinnen und Inhaber, während parallel auf der anderen Seite die Zahl an potenziellen Übernehmerinnen und Übernehmern sinkt. Eine höhere Sichtbarkeit von Positivbeispielen sowie eine bessere Informationsbereitstellung zu Finanzierungsmöglichkeiten sind Ansatzpunkte zum Gegensteuern.
Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen
Nach der Lockerung der Kreditvergabepolitik zu Jahresbeginn überwog bei den Finanzinstituten im zweiten Quartal wieder die Vorsicht. Sowohl für den Mittelstand als auch für Großunternehmen waren überdurchschnittlich hohe Hürden beim Kreditzugang zu überwinden. Während die KfW-ifo-Kredithürde (25,6 %) für KMU sich kaum bewegte, gaben merklich mehr größere Unternehmen (17,9 %) an, auf restriktive Banken zu treffen.
Positives gibt es über die kleinen und mittleren Dienstleister und die großen Bauunternehmen zu berichten. Für Kreditinteressierte aus diesen beiden Wirtschaftsbereichen gestalteten sich Kreditverhandlungen nun deutlich einfacher, nachdem sie zuvor auf besonders große Skepsis bei den Banken gestoßen waren.
Der Einstieg in das Sommerquartal ist stimmungsmäßig misslungen. Das mittelständische Geschäftsklima sinkt im Juli auf den niedrigsten Wert seit November letzten Jahres. Anders als in den Vormonaten geben diesmal die Geschäftslageurteile stärker nach als die Erwartungen. Der vorsichtige Optimismus aus dem Frühjahr hat sich verflüchtigt, die konjunkturelle Hängepartie geht vorerst weiter.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juli 2023(PDF, 160 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Grüne Gründungen können den Wandel zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen Wirtschaftsweise aktiv mitgestalten. Dabei stehen die Gründerinnen und Gründer vor spezifischen Herausforderungen, für deren Bewältigung sie Unterstützung brauchen können. Dafür ist zunächst zu klären, welche Gründungen für die grüne Transformation besonders wichtig sind und was „grün“ eigentlich bedeutet. Ein von der KfW in Auftrag gegebenes Gutachten hat sich mit diesen Fragen befasst und eine mögliche Definition erarbeitet.
Grüne Gründungen: eine Taxonomie(PDF, 143 KB, barrierefrei)
Die zugrunde liegende Studie finden Sie hier: Finanzierungs- und Förderbedarfe von Grünen Gründungen(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Analysen auf unserem Dossier Existenzgründungen
Jedes zehnte der 3,8 Mio. kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland steht im globalen Wettbewerb. Vor allem größere mittelständische Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, die zu den wesentlichen Treibern von Umsätzen, Beschäftigung und Investitionen im Mittelstand gehören, konkurrieren mit Wettbewerbern aus dem Ausland. Diese kommen häufig aus Europa, aber auch aus China, anderen Regionen Asiens und den USA. Gegenwärtig sieht sich der deutsche Mittelstand im internationalen Wettbewerb in vielerlei Hinsicht gut aufgestellt. Auch mit Blick auf ihre zukünftige Wettbewerbsposition sind die Unternehmen überwiegend zuversichtlich, sehen aber auch deutlichen Handlungsbedarf. Der Abbau von Bürokratie, die Bekämpfung des Fachkräftemangels, die Schaffung von Akzeptanz für die grüne Transformation durch die Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen, die Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung und das Vorantreiben der Digitalisierung sind wichtige Ansatzpunkte.
KfW-Internationalisierungsbericht 2023(PDF, 2 MB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Deutschlands starke Verbindung zur Weltwirtschaft
Die Studie untersucht, wie die strategische Ausrichtung von Unternehmen mit der Betroffenheit von Digitalisierungshemmnissen zusammenhängt. Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Betroffenheit von Hemmnissen mit dem Ambitionsniveau der strategischen Ausrichtung der Digitalisierungsaktivitäten steigt. So stoßen Unternehmen, die eine Vorreiterstrategie hinsichtlich einer Technologie bzw. der Kosten verfolgen, sowie Unternehmen mit einer Wachstumsstrategie häufiger als andere Unternehmen auf Hemmnisse, wie fehlendes IT-Knowhow oder fehlende Finanzierungsmöglichkeiten. Für Unternehmen, die eine Standardisierung ihrer Angebotspalette anstreben, stellen die notwendige Umstellung der Arbeits- und Unternehmensorganisation sowie der IT die herausragenden Probleme dar. Dagegen sind Unternehmen mit einer geringen strategischen Ausrichtung ihrer Digitalisierungsaktivitäten von allen Hemmnissen unterdurchschnittlich stark betroffen.
Weitere Informationen auf unserem Dossier Digitalisierung im Mittelstand
Innovatorenquote sinkt im zweiten Jahr der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren bei den Innovationsaktivitäten der mittelständischen Unternehmen. Die zentralen Untersuchungsergebnisse des aktuellen Berichts sind:
- Die Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf 40 %.
- Die Innovationsausgaben bleiben mit 33,9 Mrd. EUR in 2021 stabil gegenüber dem Vorjahr.
- Der Anteil innovativer Unternehmen steigt mit zunehmender Unternehmensgröße.
- Die Linderung des Fachkräftemangels ist zentraler Ansatzpunkt für mehr Innovationen.
KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2022(PDF, 1 MB, barrierefrei)
Weitere Informationen auf unserer Themenseite Innovationen
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht den Anteil materieller Investitionen an den Digitalisierungsausgaben. Zentrales Ergebnis ist, dass materielle Investitionen lediglich 37 % der Digitalisierungsausgaben im Mittelstand ausmachen. Vor allem bei ambitionierten Vorhaben ist der Anteil materieller Investitionen gering. Dies erschwert die Stellung von Kreditsicherheiten aus dem Projekt und dürfte - neben der Unsicherheit über den Projekterfolg - ein wesentlicher Treiber der Schwierigkeiten sein, Digitalisierungsprojekte extern zu finanzieren. Um die Finanzierungsproblematik zu lindern, bieten sich zwei Handlungsoptionen an: Ein Ansatzpunkt könnte der Ausbau des Angebots an Förderinstrumenten sein, die das Ausfallrisiko tragen und die nicht die Stellung von Sicherheiten erfordern. Ein anderer Ansatzpunkt kann sein, immaterielle Vermögenswerte – wie Markenrechte, Patente und weitere Schutzrechte für intellektuelles Eigentum – für die Nutzung als Kreditsicherheiten zu erschließen.
Weitere Informationen auf unserem Dossier Digitalisierung im Mittelstand
Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen stürzt im Juni regelrecht ab. Gegenüber dem Vormonat sinkt es um 5,4 Zähler, also fast so stark wie unmittelbar nach dem Gaslieferstopp im vergangenen September. Ursächlich ist vor allem ein Pessimismusschub bei den Erwartungen, aber auch die Lagebeurteilung gibt deutlich nach. Gute Nachrichten bietet das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im Juni lediglich mit Blick auf die künftige Inflationsentwicklung, denn der seit nunmehr neun Monaten anhaltende Rückgang der Absatzpreiserwartungen setzt sich ungebremst fort.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juni 2023(PDF, 248 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die globale Erderwärmung stellt eine Bedrohung für die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und der wirtschaftlichen Aktivitäten dar. Auch in Deutschland und Europa sind die Folgen des Klimawandels durch Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen oder Starkregen bereits deutlich spürbar. Die dadurch ausgelösten volkswirtschaftlichen Schäden sind heute schon beträchtlich.
Befragungsergebnisse aus dem KfW-Klimabarometer zeigen, dass sich 41 % der Unternehmen in Deutschland aktuell (15 %) oder perspektivisch (26 %) von den negativen Folgen des Klimawandels betroffen sehen. Dementsprechend hat auch nur ein Teil (14 %) bereits Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt. Verbesserte Informationsbereitstellung über mögliche Gefahren von Klimaphänomenen vor Ort kann die Unternehmen in Zukunft darin unterstützen, ihre Risikoeinschätzung zu schärfen und sich damit angemessen auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.
Das Geschäftsklima der kleinen und mittelständischen Unternehmen unterbricht seine Erholungsrally nach sechs Anstiegen in Folge. Ursächlich ist eine deutliche Eintrübung der Geschäftserwartungen bei einer unverändert durchschnittlichen Geschäftslage. Noch deutlicher trübt sich die Stimmung in den Großunternehmen ein. Die Absatzpreiserwartungen setzen indes ihren Abwärtstrend fort.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Mai 2023(PDF, 163 KB, barrierefrei)
Nach dem Rekordwachstum im Sommer hat sich das Geschäft mit neuen Unternehmensdarlehen im Schlussquartal 2022 wieder beruhigt. Die Entspannung an den Energiemärkten und das Abklingen der Lieferkettenprobleme sorgt dafür, dass die Unternehmen weniger Finanzierungen benötigen, um die ungeplanten Mittelbedarfe abzudecken.
Dennoch war der Anstieg des von KfW Research berechneten Kreditneugeschäfts deutscher Banken mit Unternehmen und Selbstständigen mit 19 % im Vorjahresvergleich immer noch sehr kräftig, obwohl das Wachstumstempo sich nahezu halbiert.
Im ersten Halbjahr 2023 rechnen wir mit einer Fortsetzung der Abkühlung im Kreditgeschäft. Dazu tragen neben den höheren Zinsen schwunglose Unternehmensinvestitionen und ein überdurchschnittlich schwieriger Zugang zu Bankdarlehen bei.
KfW-Kreditmarktausblick März 2023(PDF, 300 KB, barrierefrei)
Insgesamt gute, aber auch einige schlechte Nachrichten kommen vom KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im April: Unter dem Strich steigt das Geschäftsklima im Mittelstand moderat. Das ist bereits der sechste Anstieg in Folge, nachdem die Stimmung im vergangenen Herbst unter der akuten Angst vor einer Energiekrise regelrecht kollabiert war. Treiber des Anstiegs sind aber allein die Geschäftserwartungen, die Lageurteile geben nach. Wir sind gut beraten, die Erwartungen an die Konjunktur 2023 weiter niedrig zu hängen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer April 2023(PDF, 190 KB, barrierefrei)
Deutsche Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredit. Die KfW-ifo-Kredithürde für das erste Quartal 2023 liegt mit einigem Abstand unter den zuvor erreichten Höchstständen. Dennoch empfindet immer noch rund ein Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als restriktiv. Damit bleibt der Kreditzugang überdurchschnittlich schwierig.
Die Lockerung der Kreditpolitik dürfte vor allem auf die Entschärfung der Energiekrise zurückzuführen sein. Aufgrund der verbesserten gesamtwirtschaftlichen Risikolage werden Kreditausfälle weniger wahrscheinlich.
Fokus Volkswirtschaft
Das vergangene Jahr war von turbulenten Preisentwicklungen auf den Energiemärkten gekennzeichnet. Sorgen um eine überfordernde Energiekostenbelastung infolge der Energiekrise waren im Mittelstand bis zuletzt allgegenwärtig.
Eine Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel aus dem März 2023 zeigt, dass eine deutliche Entspannung mit Blick auf die Tragbarkeit des aktuellen Energiekostenniveaus zu beobachten ist. Ein Grund dafür ist, dass viele Unternehmen seit Kriegsbeginn vielfältige Maßnahmen zur Energiekostendämpfung umgesetzt haben. Daneben tragen Preisrückgänge an den Energiemärkten, eine insgesamt nachlassende Krisensymptomatik sowie die Einführung der Energiepreisbremsen zu Entspannung und erhöhter Planungssicherheit bei.
Ein Vergleich mit den Jahren vor dem Ukraine-Krieg zeigt jedoch auch, dass vor allem das Verarbeitende Gewerbe eine höhere relative Energiekostenbelastung wahrnimmt. Daher gilt es die Kostenentwicklungen bei belasteten Branchen weiterhin im Auge zu behalten.
Die Stimmung im Mittelstand blüht zu Frühlingsbeginn weiter auf: Deutliche Verbesserungen der Lageurteile wie auch der Erwartungen ziehen das Geschäftsklima im März nach oben. Es ist bereits der fünfte Anstieg in Folge. Besser gestimmt waren die Unternehmen zuletzt im Januar 2022, also unmittelbar vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Im Vergleich zu den Großunternehmen sticht vor allem ins Auge, dass die Mittelständler zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage sind.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2023(PDF, 188 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Nutzung digitaler Kommunikationswege zwischen den Unternehmen im Mittelstand und Kreditinstituten hat sichtbar zugelegt. Gleichzeitig geht die Filialnutzung zurück, wie eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt. Im Jahr 2021 nahm nur noch die Hälfte aller Unternehmen einen Geschäftstermin vor Ort in einer Bank- oder Sparkassenfiliale wahr. Insgesamt suchten 1,88 Mio. Unternehmen eine Filiale auf – und damit 560.000 Unternehmen weniger als noch im Jahr 2017. Dennoch ist der Stellenwert persönlicher Kontakte für den Mittelstand weiter ausgesprochen hoch. Das spiegelt sich in der noch immer sehr hohen Relevanz der Hausbank wider. Trotz des Rückbaus von Filialen besteht auch weiterhin ein ausgeprägtes Netz von vor allem regional orientierten Kreditinstituten, das sich für den Mittelstand auszuzahlen scheint. Im Durchschnitt benötigten die kleinen und mittleren Unternehmen im Jahr 2021 lediglich etwas mehr als 15 Minuten bis zur nächsten Filiale ihrer Hausbank.
Weitere Analysen in unserem Dossier Mittelstand
Fokus Volkswirtschaft
Das neue Nachfolge-Monitoring Mittelstand zeigt, dass jedes Jahr rund 100.000 Inhaberinnen und Inhaber mittelständischer Unternehmen eine Nachfolge anstreben. Die Relevanz des Themas Unternehmensnachfolge hat damit nichts an Aktualität eingebüßt. Rund zwei Drittel der kurzfristigen Nachfolgepläne bis Ende 2023 sind bereits in trockenen Tüchern. Jeder vierte kurzfristige Nachfolgewunsch wird sich allerdings auch mangels ausreichender Planung nicht erfüllen. Der Wunsch, die Nachfolge innerhalb der Familie zu regeln, bleibt weiter ausgeprägt. Generell ist der Mangel an passenden Kandidaten die größte Hürde einer erfolgreichen Nachfolgeregelung, die Knappheit ist aufgrund zu geringer Gründungszahlen hoch. Zusätzlich steigt der Bedarf, die Zahl der älteren Inhaberinnen nimmt zu. Aktuell sind bereits 1,2 Mio. Unternehmerinnen 60 Jahre oder älter, annähernd eine Verdreifachung in den letzten zwanzig Jahren. Die Nachfolgelücke wächst, ungewollte Stilllegungen im Mittelstand dürften zunehmen.
Weitere Analysen in unserem Dossier Mittelstand
Fokus Volkswirtschaft
Bürokratie wird in Befragungen regelmäßig als Gründungshemmnis genannt. Wo bei (angehenden) jungen Selbstständigen der Schuh genau drückt, hat sich bei einer Befragung auf gruenderplattform.de gezeigt: Bürokratie wird zum Hemmnis, wenn öffentliche Institutionen zu komplex, zu langsam, zu analog, zu wenig hilfreich und zu wenig erreichbar sind. Insbesondere die Verringerung von Komplexität durch einfache und eindeutige Kriterien sowie eine institutionenübergreifende Harmonisierung und Digitalisierung sind daher vielversprechende Ansätze, um Bürokratie als Gründungshemmnis zu verringern.
Dreiklang des Bürokratieabbaus: einfacher, schneller, digitaler(PDF, 238 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen und Informationen in unserem Dossier Existenzgründungen
Die Stimmungsaufhellung im Mittelstand setzt sich mit Beginn der Fastenzeit fort: Das Geschäftsklima steigt im Februar immerhin auf den höchsten Wert seit Juni vergangenen Jahres. Anders als im Vormonat tragen diesmal beide Komponenten des Geschäftsklimas zu der Verbesserung bei. Die deulich rückläufigen Absatzpreiserwartungen der Unternehmen lassen perspektivisch auf ein Abflauen der aktuell noch immer hohen Inflation hoffen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2023(PDF, 128 KB, barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die Diskussion um eine wachsende Zahl von Zombie-Unternehmen im Mittelstand ist nicht neu. Auftrieb erfuhren entsprechende Sorgen zuletzt dadurch, dass die befürchte Insolvenzwelle im Zuge der Corona-Krise ausblieb. Diese Sorge erscheint allerdings unbegründet. Das zeigt eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels. Nur etwa 4 % aller kleinen und mittleren Unternehmen zeigen eine kritische Schuldentragfähigkeit. Sie sind aufgrund geringer Profitabilität nicht in der Lage, ihren Zinsverpflichtungen nachzukommen. Ein Zuwachs des Anteils von finanziell schwachen Unternehmen in den Krisenjahren ist nicht auszumachen. Neben wirtschaftspolitischen Maßnahmenpaketen haben Anpassungs- bzw. Innovationsfähigkeit, eine auch in Krisenzeiten stabile Ertragskraft sowie ein in der Breite solides finanzielles Fundament den Mittelstand gut durch die Krise gebracht.
Deutlicher Digitalisierungsschub im zweiten Jahr der Corona Pandemie, Kluft zwischen Vorreitern und Nachzüglern droht sich zu vertiefen
Das zentrale Ergebnis ist, dass die Digitalisierungsausgaben im Jahr 2021 einen Höchststand erreicht haben, der Anteil der Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten jedoch gegenüber der Situation vor Corona kaum gestiegen ist. Stellenbesetzungsprobleme treffen digital aktive Unternehmen in einem besonders starken Ausmaß:
- Schub aus Corona-Pandemie hält weiter an, Unternehmen gehen verstärkt komplexe Projekte an.
- Spaltung in digitale Vorreiter und abgehängte kleine Mittelständler droht jedoch mehr denn je.
- Fehlende digitale Kompetenzen und IT-Fachkräftemangel bremsen.
KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Dossier Digitalisierung
Fokus Volkswirtschaft
Zwei aktuelle Studien von KfW Research untersuchen die Digitalisierungsaktivitäten sowie die Stellenbesetzungsprobleme mittelständischer Unternehmen.
Das zentrale Ergebnis ist, dass die Digitalisierungsausgaben im Jahr 2021 einen Höchststand erreicht haben, der Anteil der Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten jedoch gegenüber der Situation vor Corona kaum gestiegen ist. Stellenbesetzungsprobleme treffen digital aktive Unternehmen in einem besonders starken Ausmaß:
- Schub aus Corona-Pandemie hält weiter an, Unternehmen gehen verstärkt komplexe Projekte an.
- Spaltung in digitale Vorreiter und abgehängte kleine Mittelständler droht jedoch mehr denn je.
- Fehlende digitale Kompetenzen und IT-Fachkräftemangel bremsen.
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Dossier Digitalisierung
Volkswirtschaft Kompakt
Noch nie gab es so viele Unternehmen im Mittelstand mit einer Frau an der Spitze: Die Anzahl von Frauen in der Leitung eines mittelständischen Unternehmens lag im Jahr 2022 bei rund 757.000. Damit wurde jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen von einer Frau geführt, wie eine jüngste Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt. Frauen sind im Mittelstand dabei besonders in Dienstleistungsbereichen aktiv: Mehr als neun von zehn Chefinnen lenken ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen. Einen wesentlichen Anteil an der gestiegenen Frauenquote hat die wieder schwungvollere Gründungstätigkeit von Frauen am aktuellen Rand. Eine anziehende Gründungsneigung von Frauen ist der notwendige zentrale Impuls für langfristig mehr Chefinnen im Mittelstand.
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht, welche mittelständischen Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität werden. Dabei können die folgenden zentralen Ergebnisse ermittelt werden:
- Drei von zehn Mittelständlern sind in den Jahren 2018–2020 Opfer von Cyberangriffen geworden
- Digitale Vorreiter und große Mittelständler sind besonders betroffen
- Schutzmaßnahmen sind angesichts der großen Angriffsfläche für Cyberattacken unzureichend
Cyberkriminalität bedroht vor allem die Vorreiter der Digitalisierung(PDF, 261 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen im Dossier Digitalisierung
Fokus Volkswirtschaft
Die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit bleibt auch im zweiten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie niedrig. Nur 23 % der Erwerbsfähigen in Deutschland würden sich 2021 unabhängig von ihrer aktuellen persönlichen Situation für die berufliche Selbstständigkeit entscheiden. Die unter 30-Jährigen haben den Corona-Schock aber besser verdaut und würden sich wieder häufiger für die Selbstständigkeit entscheiden.
Von den Erwerbsfähigen, die noch nie selbstständig waren, können sich 32 % vorstellen, einmal selbstständig zu werden. Das ist mehr als ein Viertel aller Erwerbsfähigen (26 %) und zeigt, dass Gründungspotenziale durchaus vorhanden sind. Um diese zu heben, scheinen weniger Bürokratie, eine faire Einbindung in die Sozialversicherungssysteme und eine bessere Absicherung im Insolvenzfall vielversprechende Maßnahmen zu sein.
Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen
Der Mittelstand beginnt das neue Jahr in nochmals verbesserter Stimmung: Das Geschäftsklima steigt im Januar bereits das vierte Mal in Folge. Dahinter steht vor allem eine kräftige Aufhellung der Geschäftserwartungen. Die Befürchtungen eines steilen Konjunkturabsturzes verflüchtigen sich mehr und mehr.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2023(PDF, 145 KB, barrierefrei)
Im Schlussquartal 2022 ist die KfW-ifo-Kredithürde für kleine und mittlere Unternehmen zum dritten Mal in Folge angestiegen. 31,3 % der befragten Mittelständler, die sich in Kreditverhandlungen befanden, stufen das Verhalten der Banken als restriktiv ein. Das sind 3,4 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Die Kredithürde für den Mittelstand hat damit zugleich einen neuen Höchststand seit Einführung der aktuellen Befragungsmethodik im Jahr 2017 erreicht. Vor allem die mittelständischen Firmen aus Einzelhandel (+8,6 Prozentpunkte) und der Dienstleistungssektor (+6,7 Prozentpunkte) waren von den strafferen Kreditvergabekonditionen betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe (-2,9 Prozentpunkte) hat sich die angespannte Situation am Kreditmarkt im Vergleich zum Vorquartal leicht aufgehellt.
Volkswirtschaft Kompakt
Die Energiekrise dürfte die Unternehmenslandschaft in den Bundesländern unterschiedlich stark treffen. Das zeigt eine jüngste Auswertung des KfW-Mittelstandspanels. Danach gibt es eine deutliche Spreizung bei der relativen Energiekostenbelastung der mittelständischen Unternehmen je nach Bundesland. Auch bei den absoluten Energiekosten sind die Unterschiede deutlich ausgeprägt. Die Ursache findet sich in der regionalen Heterogenität des Mittelstands. Die grundsätzliche Größen- oder Branchenstruktur ist zwar vergleichbar. Darüber hinaus gibt es allerdings landesspezifische Besonderheiten hinsichtlich wesentlicher Merkmale der dort ansässigen Unternehmen, die einen Einfluss auf die Belastung durch die hohen Energiepreise bzw. die Betroffenheit der aktuellen Energiekrise haben können.
Weitere Informationen im Dossier Mittelstand
Das Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen in Deutschland mit Unternehmen und Selbstständigen ist im dritten Quartal 2022 um den Rekordwert von 36,1 % gestiegen, wie der neue KfW-Kreditmarktausblick von KfW Research zeigt. Das Wachstum neuer Kredite fällt damit noch einmal um 15 Prozentpunkte stärker aus als im Vorquartal. Zum Jahresende dürfte das Wachstum am Kreditmarkt jedoch beginnen nachzulassen.
KfW-Kreditmarktausblick Dezember 2022(PDF, 205 KB, barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Lieferengpässe sind nach wie vor eine Herausforderung für den deutschen Mittelstand. Hinzu kommen die gestiegenen Energiekosten aufgrund der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland und rückläufige Umsätze im In- und Ausland infolge einer schwachen Konjunktur. In Summe stellen diese Entwicklungen eine deutliche Belastung für den Mittelstand dar, wie die Ergebnisse einer Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel verdeutlichen. Besonders unter Druck steht das Verarbeitende Gewerbe, das zwar nur einen kleinen Teil der Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland ausmacht, jedoch überproportional zu Umsatz und Beschäftigung im Mittelstand beiträgt. Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in China könnten die Materialknappheit erneut verschärfen, weil dort viele Beschäftigte in Unternehmen fehlen.
Weitere Informationen zum Thema Deutschland im globalen Umfeld
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht die Leistungsfähigkeit des deutschen Innovationsökosystems. Die Stärken Deutschlands liegen in einem starken Wissenschaftssektor und ausgeprägten FuE-Aktivitäten in Großunternehmen. Schwächen können dagegen beim Wissenstransfer ermittelt werden: etwa beim Transfer neuer Technologien, der Vermarktung über Unternehmensgründungen und des Transfers hin zu kleinen und mittleren Unternehmen. Auch die Digitalisierung ist sowohl hinsichtlich der Entwicklung, der Anwendung und des Exports digitaler Technologien keine deutsche Stärke.
Die zu Grunde liegende Studie finden Sie hier: Studie zum Förderfeld Digitalisierung und Innovation(PDF, 5 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Innovationen
Das mittelständische Geschäftsklima steigt zum dritten Mal in Folge. In der Vorweihnachtszeit geht es um 4,9 Zähler auf -14,5 Saldenpunkte nach oben. Die schon im Oktober begonnene Aufhellung der Geschäftserwartungen setzt sich fort, zum ersten Mal seit Juni verbessert sich jetzt aber auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage. Die Absatzpreiserwartungen geben gleichzeitig deutlich nach.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2022(PDF, 105 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Mehrheit der Selbstständigen hat mit gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Die Energiekostensteigerungen werden aber von weniger als der Hälfte der Selbstständigen und auch nur teilweise weitergegeben, weil sie Preiserhöhungen nicht durchsetzen können. Die Energiepreisinflation bringt somit viele Selbstständige an ihre Belastungsgrenze. Wenn Energiekosten dauerhaft hoch blieben, wären viele Selbstständige finanziell überfordert. Ein Fünftel der Selbstständigen sieht die Energiekrise als existenzbedrohend an.
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht, welche Unternehmensaktivitäten zur Steigerung der Produktivität in Unternehmen führen. Das zentrale Ergebnis ist, dass nicht nur eigene Forschung und Entwicklung, sondern eine Vielzahl von Aktivitäten die Produktivität steigern. Dazu zählen beispielsweise Ausgaben für Marketing, Weiterbildungsmaßnahmen oder Digitalisierung, wie für Software oder Datenbanken. Solche Aktivitäten werden in Fachkreisen häufig Investitionen in intangibles Kapital genannt.
Investitionen in immaterielles Kapital steigern die Produktivität(PDF, 170 KB, barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Innovation
Energiepreise sind derzeit der wohl größte Belastungsfaktor für viele Unternehmen in Deutschland. Dabei waren die Energiekosten vor dem Ukraine-Krieg in der Breite des Mittelstands weitgehend überschaubar: Vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2021 betrug der Anteil der Energiekosten am Umsatz durchschnittlich 5,8 %. Die Hälfte aller Unternehmen hatte dabei maximale Energiekosten von 9.000 EUR, die andere Hälfte lag darüber. Eine besonders hohe Belastung weist allerdings das Verarbeitende Gewerbe auf. Es handelt sich hier zwar um relativ wenige Unternehmen, deren wirtschaftliches Gewicht aber beträchtlich ist.
Mit einem Plus von 3,6 Zählern auf -19,7 Saldenpunkte macht das mittelständische Geschäftsklima im November einen Satz nach oben. Ursächlich für das Nachlassen der depressiven Stimmung ist allein ein deutlicher Anstieg der Geschäftserwartungen, während die Lageurteile erneut nachgeben. Die Unternehmen sehen, dass sich das Risiko einer Gasmangellage reduziert hat und honorieren wahrscheinlich auch die kommende Gas- und Strompreisbremse. Im historischen Vergleich sind sie aber noch immer sehr pessimistisch.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer November 2022(PDF, 214 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht, ob mittelständische Unternehmen mit ihren Digitalisierungsaktivitäten auch strategische Ziele verfolgen. Das zentrale Ergebnis ist, dass Digitalisierungsaktivitäten nur selten in einem Zusammenhang mit einer Wettbewerbsstrategie stehen. Jene Unternehmen, die ihre Digitalisierungsmaßnahmen unter strategischen Gesichtspunkten durchführen, flankieren ihre Aktivitäten durch spezifische Innovationsprojekte und geben insgesamt mehr für ihre Digitalisierung aus.
Die Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 55 Mrd. EUR in den Klimaschutz investiert. Um das Ziel der Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2045 erreichen zu können, ist allerdings mehr als eine Verdopplung des jährlichen Investitionsvolumens erforderlich. Das zeigt das KfW-Klimabarometer, eine neue Unternehmensbefragung, die erstmals Klimaschutzinvestitionen für den gesamten Unternehmenssektor in Deutschland erhebt und Einblicke zu den Einstellungen und Aktivitäten der Unternehmen rund um die Umsetzung der Energiewende liefert. Die Ergebnisse zeigen auch, dass konkrete THG-Minderungsziele und die Kenntnis des eigenen CO2-Fußabdrucks in der Breite der Unternehmerschaft bisher die Ausnahme sind. Größere Unternehmen gehen hier voran. Klimaneutralität strebt bislang insgesamt nur jedes zehnte Unternehmen an. Wirtschaftliche Anreize sowie schlanke Planungs- und Genehmigungsverfahren sind wesentliche Stellhebel zur Ermöglichung der grünen Transformation in der Wirtschaft.
KfW-Klimabarometer 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen und Grafiken finden Sie auf der Themenseite KfW-Klimabarometer
Die Disruption der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Energieverknappung, Lieferengpässe und dem daraus resultierendem massiven Kostendruck ist auch am Unternehmenskreditmarkt unübersehbar. Trotz der sich anbahnenden Rezession und zunehmender Eintrübung der Finanzierungsbedingungen haben deutsche Unternehmen und Selbstständige im zweiten Quartal in großem Umfang neue Bankdarlehen aufgenommen.
Das von KfW Research berechnete Kreditneugeschäft stieg im Vergleich zum Vorjahr um immense 21,3 %. Das ist ein neuer Rekordzuwachs.
Ausschlaggebend für dieses starke Wachstum war eine Kombination aus hohem Finanzierungsbedarf für Betriebsmittel und Lagerhaltung, den Krediten der KfW an Unternehmen des Energiesektors im Auftrag des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung sowie der sehr schwachen Kreditvergabe im zweiten Quartal des Jahres 2021.
KfW-Kreditmarktausblick Oktober 2022(PDF, 216 KB, barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Viele Existenzgründungen haben Klimaschutz im Blick. Rund 60 % der Existenzgründungen 2021 bieten Produkte oder Dienstleistungen an oder setzen selbst Maßnahmen um, die zum Klimaschutz beitragen. Klimaschutzangebote stehen dabei bei jeder zehnten Existenzgründung im Fokus. Mit 58 % tragen allerdings deutlich mehr der Existenzgründungen mit eigenen Maßnahmen zum Klimaschutz bei. Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse des KfW-Gründungsmonitors.
Klimaschutz spielt bei knapp 60 % der Existenzgründungen eine Rolle(PDF, 88 KB, barrierefrei)
Während das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen in den Vormonaten wiederholt regelrecht abstürzte, verliert es im Oktober nur 0,1 Zähler und bewegt sich damit bei weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen mit Materialengpässen, Inflationsschub und dem Krieg in der Ukraine praktisch seitwärts auf dem sehr niedrigen Niveau von -23,8 Saldenpunkten. Ursächlich für die ansatzweise Stabilisierung sind etwas weniger pessimistische Geschäftserwartungen. Sowohl der fiskalische Abwehrschirm der Bundesregierung als auch die geschrumpfte Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage dürften die Erwartungen gestützt haben.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer Oktober 2022(PDF, 115 KB, barrierefrei)
Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die Energiekrise erschüttern die Grundfesten einer regelbasierten Weltordnung und des deutschen Wirtschaftsmodells. Über ein kurzfristiges Krisenmanagement hinaus sind Investitionen der Schlüssel für eine erfolgreiche Anpassung an das veränderte Umfeld. Sie ermöglichen den Umbau der Energieversorgung sowie die grüne und digitale Transformation - und verlangen gemeinsame Kraftanstrengungen von Staat, Unternehmen und privaten Haushalten. Der Löwenanteil der Investitionen muss vom Privatsektor kommen. Die aktuellen Energiekostenbelastungen und Unsicherheiten wirken indes hemmend. Umso wichtiger ist es, die private Investitionstätigkeit anzuregen und intelligent zu unterstützen. Dem Staat fällt dabei eine zentrale Rolle zu für die Formulierung von Zielbildern und das Setzen von Rahmenbedingungen und Anreizen, aber auch als Investor in Infrastruktur und Humankapital, die für die produktive Entfaltung privater Aktivitäten notwendig sind.
Ein Investitionsschub für die Transformation – was ist konkret nötig?(PDF, 229 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Investitionen in Deutschland
Zur Themenseite Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Der Mittelstand hat die Pandemie weitgehend verdaut, aber Ukraine-Krieg und Energiekrise verdüstern die Aussichten
Dem Mittelstand bleibt nach der Corona-Pandemie kaum Zeit zum Luftholen. Ukraine-Krieg und Energiekrise setzen den Unternehmen derzeit zu. Energiepreise sind der Unsicherheitsfaktor Nummer eins und die vollen Preiseffekte werden erst noch durchschlagen. Die Stimmung in den Unternehmen hat sich merklich eingetrübt. Im Jahr 2022 zeichnet sich bereits jetzt Investitionszurückhaltung, Druck auf die Eigenkapitalquoten und ein erschwerter Kreditzugang ab. Zumindest stand der Mittelstand zu Beginn der Krise auf einem soliden Fundament. Die harten Einschnitte des ersten Krisenjahres wurden im Jahr 2021 weitgehend wettgemacht. Umsätze, Beschäftigung und Profitabilität stiegen, auch die Eigenkapitalquoten erholten sich im Vorjahr deutlich. Das zeigt das KfW-Mittelstandspanel 2022 und gibt ein umfassendes Lagebild zur gegenwärtigen Situation im Herbst 2022 als auch zur Entwicklung der Unternehmen im abgelaufenen Jahr.
KfW-Mittelstandspanel 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum KfW-Mittelstandspanel
Grafiken und weitere Informationen im Dossier Mittelstand
Für mittelständische Unternehmen hat sich das Kreditklima im dritten Quartal abrupt verschlechtert. Die KfW-ifo Kredithürde für den Mittelstand ist mit einem beträchtlichen Satz auf ein neues Rekordhoch gestiegen: 27,9 % der befragten Unternehmen, die Kreditverhandlungen führten, berichteten von einem restriktiven Verhalten der Banken.
Von den Schwierigkeiten beim Kreditzugang sind von allen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) die Dienstleistungsanbieter am stärksten betroffen, gefolgt vom Verarbeitenden Gewerbe. Energiekrise, steigende Zinsen und die absehbare Rezession dürften die wesentlichen Faktoren sein, die die Banken zu einer Verschärfung ihrer Kreditvergabepolitik gegenüber den KMU veranlassen. Großunternehmen begegnen die Finanzinstitute derzeit noch mit deutlich mehr Entgegenkommen. Die Kredithürde für diese Größenklasse ist zuletzt zweimal in Folge auf nur noch 11,2 % gesunken
Der Herbst beginnt frostig, zumindest was die Stimmung in den kleinen und mittleren Unternehmen anbelangt. Der anhaltende Strom schlechter Nachrichten rund um den Krieg und die Energiekrise lässt das mittelständische Geschäftsklima im September um fast das Dreifache einer üblichen Vormonatsveränderung abstürzen. Lageurteile und Erwartungen verschlechtern sich deutlich. Das BIP dürfte schon im Sommer geschrumpft sein, mindestens zwei weitere negative Quartalsraten werden folgen: Deutschland ist auf Rezessionskurs eingeschwenkt.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer September 2022(PDF, 210 KB, barrierefrei)
Nach Corona-Knick hat sich Zahl der Start-ups 2021 wieder erholt
Der Bestand an innovations- oder wachstumsorientierten jungen Unternehmen in Deutschland hat sich wieder erholt. Nach dem coronabedingten Knick im Jahr 2020 stieg die Zahl der Start-ups 2021 auf 61.000 an. Gründerinnen und Gründer, die Venture Capital nutzen wollen, haben eher Merkmale, die den VC-Zugang erleichtern: Sie vereinen häufiger Innovations- und Wachstumsorientierung, haben häufiger einen akademischen Hintergrund, haben deutlich häufiger digitale Angebote, internetbasierte Geschäftsmodelle und internationale Zielmärkte. Dabei streben Start-up-Gründerinnen aber seltener eine VC-Finanzierung an.
Fokus Volkswirtschaft
Unter allen Folgen des Ukraine-Kriegs sind die hohen Energiepreise infolge ausbleibender Gaslieferungen aus Russland im September der größte Belastungsfaktor für die kleinen und mittleren Unternehmen aus Deutschland.
Eine Sondererhebung von KfW Research zeigt, dass sich die Mehrheit der Mittelständler dennoch weiterhin in der Lage sieht, die höheren Energiekosten auf dem Niveau von Anfang September auch längerfristig schultern zu können. Ausschlaggebend dafür sind die in der Ausgangslage moderaten Energiekostenanteile und vielfältige Anpassungsmaßnahmen der Unternehmen.
Die große Energiepreiswelle wird jedoch erst noch auf den Mittelstand zurollen, wenn Energielieferverträge mit langfristigen Preisbindungen auslaufen. Und schon heute gibt es eine Zahl von Unternehmen, die sich mit anhaltend hohen Energiekosten finanziell überfordert sehen. Das Verarbeitenden Gewerbe ist dabei besonders im Blick zu halten.
Der Cocktail aus explodierenden Energiekosten, schwindender Kaufkraft, großen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas und anhaltendem Krieg vergiftet die Stimmung immer mehr: Das mittelständische Geschäftsklima sinkt im August zum dritten Mal in Folge. Die Geschäftslageurteile bröckeln weiter ab und die Geschäftserwartungen sind so pessimistisch wie kaum jemals zuvor. Die deutsche Wirtschaft wird unseren Erwartungen zufolge 2023 um 0,3 % schrumpfen, nach einem Zuwachs von 1,4 % in diesem Jahr.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer August 2022(PDF, 133 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie vergleicht die Finanzierung von Innovationsvorhaben mit jener von materiellen Investitionen. Das zentrale Ergebnis ist, dass selbst wenig anspruchsvolle Innovationen kaum mithilfe von Bankkrediten finanziert werden – auch wenn das allgemeine Finanzierungsklima historisch günstig ist. Grund hierfür sind die spezifischen Merkmale von Innovationsvorhaben, die insbesondere einer Finanzierung mit Bankkrediten entgegenstehen.
Nach einer kurzen Phase der Stabilisierung im Frühjahr befindet sich das mittelständische Geschäftsklima zu Beginn des Sommerquartals wieder im Sinkflug. Es stürzt im Juli um 9,5 Zähler auf -15,3 Saldenpunkte ab und verliert damit fast das Vierfache einer üblichen Monatsveränderung. Die ohnehin schon sehr pessimistischen Geschäftserwartungen brechen weiter ein, aber auch die Lageurteile geben deutlich nach.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer Juli 2022(PDF, 112 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Eine aktuelle Studie im Auftrag von KfW Research untersucht die Innovationsaktivitäten, die dabei auftretenden Hemmnisse und die Positionierung von sechs verschiedenen Typen mittelständischer Unternehmen im deutschen Innovationssystem. Die zentralen Ergebnisse sind:
- Kleine und mittlere Unternehmen steuern ein Drittel der Innovationsleistung der deutschen Wirtschaft bei.
- Auch innovative Unternehmen ohne FuE erzielen beachtliche Innovationserfolge.
- Der Anteil von nicht innovativen Unternehmen ist in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozentpunkte gestiegen.
- Fachkräftemangel und hohe Kosten: Die Innovationshemmnisse haben seit Mitte der 2000er-Jahre deutlich zugenommen.
Die zugrunde liegende Studie finden Sie hier: Studie zu den Treibern und Hemmnissen der Innovationstätigkeit im deutschen Mittelstand(PDF, 2 MB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Nicht alle Unternehmenslenkerinnen und -lenker streben nach dem eigenen Rückzug die Fortführung des Unternehmens an. Rund 266.000 mittelständische Unternehmen werden nach aktueller Einschätzung von ihren Inhaberinnen und Inhabern bis zum Ende des Jahres 2025 stillgelegt – ohne den Weg einer Nachfolge beschreiten zu wollen. Dabei sind Nachfolgermangel – vor allem fehlendes Interesse von Familienangehörigen an einer Übernahme – , das nahende Erreichen des Rentenalters und eine oftmals geringe wirtschaftliche Attraktivität ausschlaggebende Faktoren. Weitere rund 199.000 Unternehmerinnen und Unternehmer stehen einer unfreiwilligen Geschäftsaufgabe gegenüber. Sie wünschen sich eine Nachfolgelösung bis Ende des Jahres 2025, müssen aber aufgrund bislang unzureichender Planung mit einem Scheitern rechnen.
Während die Stimmung unter den Großunternehmen deutlich sinkt, meldet der Mittelstand im Juni insgesamt ein stabiles Geschäftsklima. Dahinter stehen allerdings gegenläufige Bewegungen bei Geschäftslage und Erwartungen. Während die Lageurteile zum dritten Mal in Folge steigen, werden die Geschäftserwartungen immer pessimistischer. Vor allem der deutlich wahrscheinlicher gewordene Lieferstopp von russischem Gas ist ein handfester Grund für Rezessionssorgen.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer Juni 2022(PDF, 114 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Mittelständische Unternehmen mit einer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie geben mehr für ihre Digitalisierung aus und führen breiter angelegte Digitalisierungsaktivitäten durch. Auch nutzen sie häufiger anspruchsvolle digitale Technologien. Um die Potenziale der Digitalisierung besser zu erschließen, erscheint es dringend erforderlich, mittelständische Unternehmen für die strategische Bedeutung der Digitalisierung zu sensibilisieren.
Die leichte Stimmungsaufhellung in den mittelständischen Unternehmen setzt sich im Mai den zweiten Monat in Folge fort. Gleichwohl bleibt das Geschäftslima noch immer weit hinter dem Niveau vor dem Kriegsüberfall Russlands auf die Ukraine zurück. Zudem verbessern sich diesmal ausschließlich die Lageurteile, die Geschäftserwartungen werden hingegen noch pessimistischer. Die Unternehmen blicken in einen konjunkturellen Abgrund. Wie tief sie hineinfallen, steht aber auf einem anderen Blatt.
KfW-ifo Mittelstandsbarometer Mai 2022(PDF, 136 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Der Generationenwechsel im Mittelstand schreitet voran. Bis zum Ende des Jahres 2025 streben 16 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine Nachfolgelösung an. Doch die Hürden sind hoch, wie eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt: Drei Viertel aller KMU betrachten es als Problem, eine geeignete Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger zu finden. Die Einigung auf einen Kaufpreis sehen knapp 40 % KMU als wesentliche Hürde. Unter den ca. 600.000 KMU, die die Nachfolge bis Ende 2025 anstreben, droht etwa 165.000 die unfreiwillige Stilllegung oder zumindest eine erhebliche Verzögerung. Entscheidend für das Gelingen der Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist die Aktivierung und Unterstützung potenzieller Übernahmegründerinnen und -gründer.
Gründungstätigkeit 2021 zurück auf Vorkrisenniveau: mehr Chancengründungen, mehr Jüngere, mehr Gründerinnen
Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist nach dem Corona-Knick 2020 im Jahr 2021 wieder auf das Vorkrisenniveau gestiegen. Mit 607.000 Existenzgründungen haben sich 70.000 bzw. 13 % mehr Menschen selbstständig gemacht als 2020. Dabei ist die Zahl der Chancengründungen gestiegen. Auch haben sich mehr Jüngere und mehr Frauen selbstständig gemacht. Durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie waren 2021 auch deutlich mehr Gründungen digital und internetbasiert. Trotz sinkender Planungsquote ist zu erwarten, dass sich die Gründungstätigkeit 2022 auf einem ähnlichen Niveau bewegen wird wie 2021.
KfW-Gründungsmonitor 2022(PDF, 526 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind bereits jetzt im Mittelstand spürbar: In den Monaten Januar–April 2022 lagen die Energiekosten bei 54 % der Unternehmen höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Durchschnitt sind die Energiekosten dabei um 41 % gestiegen. Dennoch sieht sich die Mehrheit der Unternehmen in der Lage, auch längerfristig höhere Energiekosten auf dem aktuellen Niveau finanziell schultern zu können. Ausschlaggebend dafür ist: Energiekosten machen oft nur einen kleinen Anteil der Gesamtkosten aus. Zudem dürften Preissteigerungen an den Energiemärkten noch nicht vollständig angekommen sein. Nicht zuletzt gibt ein Großteil der Unternehmen die Kostenerhöhung bei Energie seit Kriegsbeginn über Preiserhöhungen an die Kunden weiter. Es zeigt sich auch: Viele KMU werden aktiv und ergreifen derzeit als Reaktion auf hohe Preise und Risiken ihrerseits Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien.
Fokus Volkswirtschaft
In den kommenden zehn Jahren werden Fachkräfteengpässe spürbar zunehmen. Wie eine repräsentative Befragung von KfW Research zeigt, sieht die Bevölkerung den Bedarf einer aktiven Einwanderungspolitik sehr deutlich: 83 % der 18- bis 67-Jährigen sind für mindestens gleichbleibende Bemühungen um ausländische Fachkräfte, darunter 48 % für größeres Engagement. Im Vergleich zu einer identischen Befragung vor drei Jahren ist die migrationspolitische Haltung insgesamt offener geworden, unterscheidet sich aber nach wie vor deutlich nach der beruflichen Bildung, dem Einkommen und dem Arbeitsmarktstatus. Bei niedrigeren Berufsabschlüssen und Einkommen bzw. Arbeitslosigkeit verschiebt sich das Stimmungsbild deutlich (ohne jedoch zu kippen).
Weitere Informationen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Fokus Volkswirtschaft
Gerade kleine, regional agierende und nicht-innovative Unternehmen verfügen selten über eine unternehmensweite Digitalisierungsstrategie – selbst wenn sie (einzelne) Digitalisierungsvorhaben durchführen. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass sich viele dieser Unternehmen über die strategische Bedeutung der Digitalisierung nicht bewusst sind. Um die Potenziale der Digitalisierung besser zu erschließen, erscheint es dringend erforderlich, gerade diese Unternehmen für die strategische Bedeutung der Digitalisierung zu sensibilisieren.
Der Mittelstand hat den unmittelbaren Kriegsschock fürs Erste verdaut. Sein Geschäftsklima fängt sich im April wieder ein wenig, nachdem die Stimmung im Monat zuvor infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine kollabiert war. Mit dem Zuwachs wird gleichwohl nur knapp ein Achtel des Einbruchs im März kompensiert. Der weitere Konjunkturverlauf hängt von vielen Unwägbarkeiten ab.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer April 2022(PDF, 116 KB, barrierefrei)
Ukraine-Konflikt verschärft globale Lieferengpässe – und gefährdet Erholung des mittelständischen Auslandsgeschäfts
Der Ukraine-Krieg führt zu neuen Störungen in globalen Lieferketten, die infolge der Corona-Pandemie ohnehin unter Druck stehen. Auch im Mittelstand bleiben die Belastungen durch Lieferengpässe hoch. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen, die Rohstoffe oder Vorprodukte aus dem Ausland beziehen – insbesondere aus China, Russland und dem Vereinigten Königreich. Infolge der Materialknappheit hat zuletzt jeder vierte Mittelständler seine Preise anheben müssen. Lieferengpässe bleiben damit ein Inflationstreiber.
Corona-Pandemie und Lieferkettenstörungen haben sich auch im deutschen Außenhandel und damit in den mittelständischen Auslandsumsätzen niedergeschlagen. Diese sind im Jahr 2020 um rund 11 % eingebrochen. Mit 533 Mrd. EUR lagen sie auf dem tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Im Jahr 2021 haben sich die mittelständischen Auslandsumsätze leicht erholt, sind aber unter dem Vorkrisenniveau geblieben. Ihre weitere Entwicklung unterliegt einer hohen Unsicherheit.
KfW-Internationalisierungsbericht 2022(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Mehr Veröffentlichungen zum Thema Deutschlands starke Verbindung zur Weltwirtschaft
Fokus Volkswirtschaft
Die aktuelle Studie von KfW Research untersucht die Hemmnisse der Digitalisierung im Mittelstand. Das zentrale Ergebnis ist, dass fehlendes Knowhow, Mängel bei der digitalen Infrastruktur und Schwierigkeiten bei der Finanzierung bremsen. Auf Hemmnisse stoßen in der Regel vor allem Unternehmen mit ambitionierten Digitalisierungsvorhaben. Finanzierungshemmnisse betreffen dagegen – aufgrund ihrer typischerweise schwächeren Bonität – häufiger kleine Unternehmen.
Vielfältige Hemmnisse bremsen die Digitalisierung im Mittelstand(PDF, 401 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen im Dossier Digitalisierung
Fokus Volkswirtschaft
Im Mittelstand werden die Auswirkungen der Omikron-Welle sichtbar: Im März 2022 nimmt die Corona-Betroffenheit der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wieder zu. Die Erholung kommt (vorerst) zum Stillstand. Insbesondere industrielle Mittelständler und Bauunternehmen haben aktuell stark mit den Pandemiefolgen zu kämpfen. Vor allem die Belastung durch Personalausfälle steigt erheblich an. Zugleich sind die pandemiebedingten Umsatzeinbußen noch immer signifikant. So ist die Liquiditätslage etwas angespannter als zuvor, die finanzielle Situation im Mittelstand ist aber weiter solide und die Kapitalstruktur der Unternehmen bleibt intakt.
Unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine ist das Geschäftsklima im deutschen Mittelstand abrupt eingebrochen. Mit -9,4 Zählern liegt es jetzt auf einem ähnlichen Niveau wie während der 2. Covid-Welle im Winter 2020/2021. Getrieben wurde der Stimmungseinbruch vor allem von den Geschäftserwartungen, die schlagartig um 25,9 Zähler zurückgehen, was der größte Absturz seit Beginn der Zeitreihe ist. Die aktuelle Geschäftslage wird dagegen nur etwas schlechter als im Vormonat beurteilt. Letztendlich werden die wirtschaftlichen Auswirkungen von der Dauer des Krieges sowie der militärischen und sanktionspolitischen Eskalationsspirale abhängen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2022(PDF, 135 KB, barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die Mehrheit der Mittelständler in Deutschland macht sich angesichts des Ukraine-Kriegs nur wenig Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation. Etwa jedes siebte kleine und mittelständische Unternehmen sieht in dem Konflikt jedoch hohe Risiken für seine Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten. Dies zeigen die repräsentativen Ergebnisse einer Sonderbefragung zum KfW-Mittelstandspanel im März 2022. Tiefer sind die Sorgenfalten vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und im Handel. Die schwächere Konjunktur, steigende Energiepreise und bei einigen auch das Risiko gestörter Lieferketten und wegbrechender Absatzmärkte sind hierfür ausschlaggebend.
Der Ukraine-Konflikt birgt Risiken – auch für den deutschen Mittelstand(PDF, 163 KB, barrierefrei)
Zwei aktuelle Studien von KfW Research untersuchen die Entwicklung der Digitalisierungsaktivitäten mittelständischer Unternehmen während der Corona-Pandemie. Das zentrale Ergebnis ist, dass Corona zu einem Schub bei der Digitalisierung geführt hat, die Digitalisierung sich jedoch nicht zu einem Selbstläufer entwickelt:
- 35 % der Mittelständler weiten ihre Aktivitäten seit Pandemiebeginn aus.
- Die Sorge vor dauerhafter Abwanderungen der Kunden hin zu digitalen Angeboten ist eine starke Triebfeder.
- Das volle Potenzial der Digitalisierung wird weiter nicht gehoben: komplexe Vorhaben werden zu selten angegangen.
KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2021(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen im Dossier Digitalisierung
Volkswirtschaft Kompakt
Für den Innovationsstandort Deutschland stellt die Abwanderung von Start-ups einen Verlust von Knowhow und Beschäftigungspotenzial dar. Für den Schritt ins Ausland ist nach Einschätzung deutscher Wagniskapitalgeber ein besseres Finanzierungsumfeld der wichtigste Entscheidungsfaktor. So zählen bessere Finanzierungs- und Exitmöglichkeiten sowie ein vorteilhafteres Bewertungsniveau zu den bedeutendsten Abwanderungsmotiven deutscher Start-ups.
Finanzierungsumfeld wichtigstes Motiv bei der Abwanderung von Start-ups(PDF, 131 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Frauenquote im Mittelstand ist im zurückliegenden Jahr auf 16 % zurückgegangen. Bei insgesamt 608.000 kleinen und mittleren Unternehmen steht eine Frau an der Spitze. Neun von zehn dieser Unternehmen sind in Dienstleistungsbereichen angesiedelt. Dabei ist die Leitung eines mittelständischen Unternehmens zunehmend für Akademikerinnen interessant. Der Akademisierungsgrad unter den Inhaberinnen hat enorm zugelegt. Die wirtschaftliche Bedeutung der frauengeführten Mittelständler ist nicht zu unterschätzen, bleibt aber aufgrund des Fokus auf kleinere Dienstleistungsunternehmen weiter unterproportional. Merkliche Impulse für den Chefinnenanteil sind aufgrund zurückhaltender Gründungsneigung kurzfristig nicht in Sichtweite. Auch die für Großunternehmen verabschiedeten Führungspositionen-Gesetze konnten bislang keinen Auftrieb geben.
Weitere Informationen zu Frauen in Führungspositionen
Die Entspannung der Pandemielage sorgt für einen breiten und kräftigen Anstieg des Geschäftsklimas im Mittelstand. Sowohl die Urteile zur aktuellen Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen verbessern sich sehr deutlich. In den Großunternehmen geht die Stimmung ebenfalls spürbar nach oben. In gewöhnlichen Zeiten hätte man sich darüber unumwunden freuen können. Doch die Zeiten sind alles andere als gewöhnlich: Über der weiteren Wirtschaftsentwicklung hängt nun das Damokles-Schwert des neuen Krieges in Europa einschließlich der davon angestoßenen Sanktionen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2022(PDF, 157 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Start-ups, die auf sehr neuen Technologien beruhen oder auf noch (weiter) zu entwickelnden Technologien basieren, können volkswirtschaftlich eine wichtige Rolle spielen. Investoren versuchen zunehmend deren Potenzial zu entfalten: International entfällt ein größer werdender Anteil am wachsenden Venture Capital-Markt auf Biotech- und Deeptech-Start-ups – auch in Deutschland. Hier ist der VC-Markt bezogen auf die Wirtschaftskraft aber kleiner als in relevanten Vergleichsmärkten. Der Rückstand auf die USA und UK ist groß. So gibt es trotz der Fortschritte in Deutschland weiteren Handlungsbedarf.
Im Januar leben viele von der Hoffnung auf den Sommer, gerade in Zeiten der Pandemie. Das gilt insbesondere für die mittelständischen Unternehmen, die aktuell mit staatlichen Einschränkungen, Konsumzurückhaltung oder indirekten Pandemiefolgen wie den globalen Lieferengpässen kämpfen. Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt, dass viele von ihnen zwar zu Jahresbeginn eine weitere Verschlechterung der Geschäftslage beklagen, aber immerhin auch wieder deutlich optimistischer in die nahe Zukunft blicken.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2022(PDF, 168 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Nachdem das Lockdown-Jahr 2020 die Zukunftsplanungen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf Eis gelegt hatte, rückt das Nachfolgemanagement nun wieder höher auf der Agenda. Bis zum Ende des Jahres 2022 streben rund 230.000 der 3,8 Mio. KMU eine Nachfolge an, bis Ende 2025 sind es ca. 600.000. Auch wenn zumindest bei den kurzfristig anstehenden Nachfolgevorhaben oft bereits ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden wurde, besteht in Deutschland eine strukutrelle Nachfolgelücke. Einer alterndern Unternehmerschaft stehen zu wenige jüngerer Personen mit zu geringer Gründungsneigung gegenüber. Die Nachfolge innerhalb der Familie ist in der Krise zwar beliebter denn je, doch mittelfristig wird der Anteil externer Übergaben allein schon aus demografischen Gründen wieder zunehmen müssen.
Fokus Volkswirtschaft
Wie das KfW-Mittelstandspanel zeigt, hat im Jahr 2020 nur etwas mehr als ein Drittel (36 %) der kleinen und mittleren Unternehmen Weiterbildung selbst durchgeführt oder gefördert, im Durchschnitt für die Hälfte ihrer Belegschaft. Die aggregierten Weiterbildungsausgaben des Mittelstands belaufen sich auf ungefähr 10 Mrd. EUR bzw. ca. 5 % der gesamten mittelständischen Investitionen in Anlagen und Bauten. Diese ernüchternden Zahlen sind eine Bestandsaufnahme inmitten der Corona-Krise, doch selbst eine zügige Rückkehr zum Vorkrisenniveau würde den aktuellen Herausforderungen des Strukturwandels nicht gerecht. Problem ist, dass der Weiterbildungssektor im Status quo zu unübersichtlich und informell ist, er weist Angebotslücken und zu geringe Teilnahmequoten auf. KfW Research sieht die wesentlichen Stellschrauben für systematische und hochwertige Weiterbildung in der Breite auf drei Gebieten: 1. Verbesserung des Angebots, 2. finanzielle Förderung, 3. Schaffung von Zeitressourcen.
Omikron treibt den Mittelständlern zusätzliche Sorgenfalten in die Stirn. Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen verschlechtert sich im Dezember deutlich und setzt damit seinen im Juli begonnenen und lediglich im Oktober unterbrochenen Abwärtstrend fort. Erstmals seit April fällt die Stimmung wieder unter den historischen Durchschnitt. Die Erwartungskomponente allein notiert inzwischen sogar tief im pessimistischen Bereich. Am winterlichen Konjunkturhimmel ziehen dunkle Wolken auf und verdüstern den Ausblick auf 2022.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2021(PDF, 105 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Innovationen wirken sich positiv auf die Performance von mittelständischen Unternehmen aus. Innovatoren wachsen schneller und weisen eine höhere Produktivität auf als vergleichbare Unternehmen ohne Innovationen. Dies sind die zentralen Ergebnisse, die unter Verwendung eines Matching-Ansatzes – einer modernen Methode der Evaluationsforschung – ermittelt werden konnten.
Fokus Volkswirtschaft
Die Transformation Deutschlands hin zur Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts ist eine zentrale Herausforderung. Der Mittelstand als prägender Bestandteil der Unternehmenslandschaft steht in besonderer Verantwortung. Anhand des KfW-Mittelstandspanels lassen sich nun erstmals die Klimaschutzinvestitionen des Mittelstands beziffern: Im Jahr 2020 haben rund 460.000 Unternehmen insgesamt 22 Mrd. EUR in Vorhaben investiert, die auch dem Klimaschutz dienen. Damit floss etwa jeder zehnte vom Mittelstand investierte Euro in Klimaschutzvorhaben. Zudem planen drei von zehn Unternehmen verstärkt in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu investieren, um die Krisenfestigkeit gegenüber Klimaphänomenen zu erhöhen. Generell gilt: Größere Unternehmen und das Verarbeitende Gewerbe zeigen ein höheres Engagement. Hier ist das Potenzial zur Einsparung von Treibhausgasemissionen am größten. Um Klimaneutralität zu erreichen wird es aber auch auf den Dienstleistungssektor ankommen.
Das mittelständische Geschäftsklima geht im November deutlich nach unten. Sowohl die Lagebeurteilungen als auch die Erwartungen befinden sich im Sinkflug. Während Pandemiesorgen das Dienstleistungssegment und viele Einzelhandelsunternehmen belasten, ächzt das Verarbeitende Gewerbe unter hartnäckigen Materialengpässen. Branchenübergreifend wollen angesichts der Knappheiten so viele kleine und mittlere Unternehmen ihre Preise anheben wie nie zuvor, zunehmend auch in den verbrauchernahen Bereichen wie dem Einzelhandel.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer November 2021(PDF, 97 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Corona-Krise hat dem mittelständischen M&A-Markt im Jahr 2020 einen Dämpfer verpasst. Die Anzahl an M&A-Transaktionen, die auf ein deutsches KMU zielten, ging im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 45 % zurück. Insbesondere inländische Investoren zeigten sich zurückhaltend. Ausländische Käufer – allen voran Investoren aus den USA sowie aus Großbritannien – waren im Jahr 2020 dagegen merklich häufiger im mittelständischen M&A-Markt vertreten. Grundsätzlich wurde die Käuferseite klar von Finanzinvestoren dominiert.
Besonders gefragt waren im vergangenen Jahr IT- und Informationsdienstleister. Die Corona-Krise und der damit verbundene zusätzliche Digitalisierungsschub haben ihren Anteil an M&A-Transaktionen im Mittelstand deutlich steigen lassen – auf rund 26 %.
Marktzahlen für das laufende Jahr deuten auf eine kräftige Erholung des deutschen M&A-Markts hin.
Fokus Volkswirtschaft
Die Unternehmensinvestitionen in Deutschland sind (zu) niedrig. Die Corona-Krise hat dabei einen bereits längerfristigen Trend nochmals verschärft, speziell im Mittelstand. Doch steht gerade jetzt die Transformation in Richtung Klimaneutralität und Digitalisierung auf der Agenda. Das erfordert enorme Investitionen. Zuversicht ist dabei die zentrale Stellschraube, damit Unternehmen Investitionen angehen. Investitionsbereitschaft, -höhe und Zielrichtung sind entscheidend von der Geschäftserwartung der Unternehmer und Unternehmerinnen abhängig. Auch demografische Prozesse spielen eine große Rolle. Die Neigung zu investieren sinkt mit dem Alter. Vor allem bei kleinen Unternehmen sind Investitionsentscheidungen an die Person des Inhabenden gekoppelt. Klassische Faktoren spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Die Wirtschaftspolitik kann helfen: Grundlegende Voraussetzung für rege Unternehmensinvestitionen sind sichere wirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen.
Warum Unternehmen (nicht) investieren(PDF, 143 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Im Jahr 2020 ist die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit in der Erwerbsbevölkerung gesunken. Nur 25 % würden sich unabhängig von ihrer aktuellen Situation für die Selbstständigkeit als Erwerbstätigkeit entscheiden. In den Vorkrisenjahren ist der Gründungsgeist bei jungen Erwachsenen wiedererstarkt. Einen Schub gab es insbesondere von Studierenden. Dieser Gründungsgeist hat sich jetzt aber wieder verflüchtigt. Bei Frauen ist die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit relativ stärker gesunken als bei Männern. Den Gründungsgeist neu zu entfachen ist eine wichtige, wenn auch herausfordernde Aufgabe.
Nach drei Rückgängen in den Vormonaten steigt das mittelständische Geschäftsklima im Oktober wieder leicht an und unterbricht damit seinen Abwärtstrend. Ursächlich für den Anstieg sind sowohl verbesserte Lageurteile als auch geringfügig optimistischere Erwartungen. Bei den Großunternehmen setzt sich die Stimmungseintrübung dagegen ungebremst fort.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Oktober 2021(PDF, 104 KB, nicht barrierefrei)
Mittelstand beweist Anpassungsfähigkeit in der Corona-Krise – Fundament der Kleinen allerdings mit sichtbaren Rissen
Der Mittelstand ist insgesamt glimpflich durch das Krisenjahr 2020 gekommen. Das zeigt das KfW-Mittelstandspanel 2021. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit haben die kleinen und mittleren Unternehmen die Lasten der Corona-Krise gut wegstecken lassen. Vor allem der rasche Ausbau digitaler Vertriebswege hat die Umsatzverluste auf 277 Mrd. EUR begrenzt. Trotz Eintrübung der Ertragslage ist der befürchtete, massive Einbruch der Eigenkapitalausstattung in der Breite ausgeblieben. Die Kapitalstruktur der KMU zeigt sich im Aggregat stabil. Kleinere Unternehmen haben allerdings herbe Einschnitte hinnehmen müssen. Gelitten haben auch die Investitionen. Nie zuvor wurden so viele Pläne nicht umgesetzt und kleinere Projekte zur Krisenanpassung haben dominiert. An der Schwelle zur klimaneutralen Transformation und angesichts eines hohen Nachholbedarfs bei der Digitalisierung stehen die Unternehmen weiterhin vor großen Herausforderungen.
Fokus Volkswirtschaft
Die digitale Transformation ist ein wichtiger Treiber für technologischen Fortschritt und Wachstum. Allerdings rangiert Deutschland bei der Anwendung digitaler Technologien in der Wirtschaft im EU-Vergleich bestenfalls im Mittelfeld und auch die Entwicklung solcher Technologien zählt nicht zu den Stärken des deutschen Innovationssystems.
Damit Deutschland zu anderen großen Ländern aufschließt, sind deutlich höhere Investitionen in diese Technologien notwendig. Um etwa mit Frankreich, Japan oder dem Vereinigten Königreich zumindest gleichzuziehen, müssten die jährlichen IT-Investitionen in Deutschland auf das Doppelte bis Dreifache – d. h. von zuletzt 49 Mrd. auf 100 bis 150 Mrd. EUR – steigen.
Fokus Volkswirtschaft
Das Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als noch vor einigen Monaten prognostiziert. Ein Grund sind die Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, die auch weite Teile des Mittelstands erfasst haben: Nahezu die Hälfte aller kleinen und mittleren Unternehmen ist davon betroffen, im Verarbeitenden Gewerbe und in der Bauindustrie sind es sogar fast 80 %.
In der Folge kommt es zu Produktionsstörungen, Liefertermine können nicht eingehalten und Kundenaufträge müssen abgelehnt werden. Etwa jeder vierte Mittelständler sieht sich gezwungen, die teils drastischen Preissteigerungen bei Rohstoffen wie Stahl, Holz oder Kunststoff und Vorprodukten wie Mikroprozessoren an seine Kunden weiterzugeben. Die Auswirkungen auf die Beschäftigung sind bisher eher gering. Mit einer schnellen Auflösung der Lieferengpässe rechnen allerdings nur wenige Unternehmen.
Lieferengpässe in der Breite des Mittelstands deutlich spürbar(PDF, 164 KB, nicht barrierefrei)
Mit dem dritten Rückgang in Folge ist das Geschäftsklima unter den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland auf einen Abwärtstrend eingeschwenkt. Wie das Wetter war auch die Konjunktur in diesem Spätsommer durchwachsen. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe gibt die Stimmung angesichts der allgegenwärtigen Engpässe bei Materialien und Lieferkapazitäten deutlich nach. Doch es gibt auch Lichtblicke, denn bei den Dienstleistungsunternehmen und vor allem im Bau verbessert sich das Geschäftsklima.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer September 2021(PDF, 101 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Das Unternehmensumfeld und die damit zusammenhängenden Wettbewerbsstrategien beeinflussen das Innovations- und Digitalisierungsverhalten von mittelständischen Unternehmen. Innovative Unternehmen agieren auf besonders herausfordernden Märkten. Kurze Produktlebenszyklen, technologische Unsicherheit und Wettbewerber aus dem Ausland führen dazu, dass die betroffenen Unternehmen stark auf die Entwicklung neuer Produkte abzielen. Dagegen prägt die Märkte von Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten, dass die Nachfrage stark vom Preis abhängig ist. Die strategische Ausrichtung eines Unternehmens spielt für die Digitalisierung eine geringere Rolle als für Innovationen. Sowohl innovative Unternehmen, als auch jene mit Digitalisierungsaktivitäten agieren erfolgreicher als Unternehmen ohne diese Aktivitäten.
Corona-Krise belastet Zahl der Start-ups – VC-affine Start-ups aber nur wenig betroffen
Der Bestand an innovations- oder wachstumsorientierten jungen Unternehmen in Deutschland hat durch die Corona-Krise gelitten. Im Jahr 2020 ging die Zahl der Start-ups auf 47.000 zurück. Im Vergleich zum Rückgang der Start-ups insgesamt blieb die Zahl der Venture Capital-affinen Start-ups mit 8.600 relativ stabil. Frauen sind im Start-up-Ökosystem deutlich unterrepräsentiert. Im langjährigen Durchschnitt machen Gründerinnen bei Start-ups 20 % aus und damit nur etwa die Hälfte des Anteils im Gründungsgeschehen insgesamt.
Fokus Volkswirtschaft
Die Digitalisierung gehört im Mittelstand zum Geschäftsalltag. Für über 80 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind grundlegende Digitalkompetenzen wie z. B. die Bedienung von Computern, Tablets und Standardsoftware von großer Bedeutung. Ein Viertel der KMU hat zudem Bedarf an fortgeschrittenen Fähigkeiten wie Programmieren oder Datenanalyse. Eine Sonderbefragung im KfW-Mittelstandspanel zeigt, dass es einem von drei Unternehmen an dringend benötigten Digitalkompetenzen mangelt. Eine Weiterbildungsoffensive könnte verhindern, dass fehlende Digitalkompetenzen zum wesentlichen Hemmnis des digitalen Strukturwandels werden.
Die sehr ansteckende Delta-Variante hat nach der weitgehenden Rücknahme der Lockdown-Maßnahmen eine vierte Corona-Welle in Deutschland losgetreten, gleichzeitig erweisen sich die Engpässe bei Rohstoffen und Vorleistungsgütern in der Industrie als hartnäckiger als ursprünglich befürchtet. Beides befeuert neue Sorgen um die künftige wirtschaftliche Entwicklung, die das mittelständische Geschäftsklima im August zum zweiten Mal in Folge nach unten ziehen. Treiber des jüngsten Rückgangs ist erneut allein die Erwartungskomponente des Geschäftsklimas, die Lageurteile steigen dagegen auf ein neues Jahreshoch.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: August 2021(PDF, 169 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die Ausbildungsaktivität, die weit überwiegend in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) stattfindet, wurde durch die Corona-Krise stark beeinträchtigt. Bei 28 % der Ausbildungsunternehmen ist im Jahr 2020 die Anzahl der Azubis gesunken. Insgesamt gab es in Deutschland einen Rückgang um 3 % von 1,33 auf 1,29 Mio. Azubis. Eine aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels ergibt auch für das gerade gestartete Ausbildungsjahr eine negative Tendenz: 26 % der Ausbildungsunternehmen rechnen auch im Jahr 2021 mit einem Rückgang. Trotz der in Fahrt kommenden Konjunktur ist eine schnelle Erholung des Ausbildungsmarkts unwahrscheinlich.
Neues Ausbildungsjahr 2021: schnelle Erholung unwahrscheinlich(PDF, 123 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die aktuelle Studie von KfW Research stellt fest, dass die Corona-Pandemie spürbare Folgen im Mittelstand hinterlässt. Die Auswirkungen der Krise treffen den Mittelstand jedoch nicht einheitlich, sondern treten verstärkt in einzelnen Segmenten auf. Rückschläge bei der Eigenkapitalquote müssen vor allem kleine Unternehmen, auslandsaktive Unternehmen sowie Unternehmen mit bereits vor der Krise schwachen Bonitäten verzeichnen. Eine höhere Krisenfestigkeit kann dagegen bei Unternehmen ermittelt werden, bei denen die Bonitätseinstufung auf ausgeprägte Managementfähigkeiten hinweist sowie bei Unternehmen, die bereits im Vorfeld Innovations- und Digitalisierungsprojekte durchgeführt haben. Die Krisenerfahrung zeigt, dass wir nach der akuten Krisenbewältigung wirtschaftspolitische Schwerpunkte auf Krisenfestigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaneutralität setzen müssen.
Weitere Informationen auf der Themenseite Gestärkt aus der Corona-Krise gehen
Fokus Volkswirtschaft
Die Corona-Pandemie hat unser Konsum- und Bewegungsverhalten stark verändert. Einige dieser Veränderungen werden wohl auch nach einem Ende der Pandemie bleiben. Das wird nachhaltige Auswirkungen auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland haben – dies zeigen die Ergebnisse einer Sonderbefragung im Rahmen des KfW-Mittelstandspanels. Rund 14 % der Mittelständler erwarten, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen nach der Krise stärker gefragt sein werden als davor. Gleichzeitig rechnen jedoch 17 % der KMU mit einem dauerhaften Nachfragerückgang. Ein Transformationsprozess wird für den davon betroffenen Teil des Unternehmenssektors wohl unumgänglich sein. Diesen gilt es mit geeigneten Fördermaßnahmen und Qualifikationsangeboten für die Beschäftigten zu begleiten.
Zur Themenseite Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen
Lange kannte das mittelständische Geschäftsklima nur den Weg nach oben. Jetzt erhält es einen Dämpfer und geht zum ersten Mal seit Januar wieder zurück. Ursächlich sind vor allem Sorgen über die wieder steigenden Inzidenzen. Das Geschäftsklima unter den kleinen und mittleren Unternehmen sinkt allein erwartungsbedingt, während sich die Lagebeurteilung nochmals leicht verbessert.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juli 2021(PDF, 98 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Digitalisierung macht auch vor der Unternehmensfinanzierung nicht Halt. So besteht mittlerweile die Möglichkeit, Finanzierungen über Online-Kreditplattformen digitaler Anbieter im Internet abzuwickeln. Hier zeigt das KfW-Mittelstandspanel: Die Kreditfinanzierung über Online-Kreditplattformen ist im Mittelstand noch eine große Ausnahme. 2018 und 2019 nutzten rund 77.000 KMU diese Finanzierungsalternative mit einem Gesamtvolumen von 3,4 Mrd. EUR. In aller Regel handelte es sich um niedrige Finanzierungsvolumen. Allerdings gibt es ein (sehr) kleines Segment von Unternehmen, die Kreditplattformen sehr stark nutzen. Geschwindigkeit bis zur Finanzierungszusage und geringer Antragsaufwand sind Pluspunkte der Kreditplattformen. Auch kurzfristig ist nur geringes Wachstum zu erwarten. Die Corona-Pandemie könnte die Akzeptanz für digitale Finanzdienstleistungen jedoch grundsätzlich erhöhen und somit auch Online-Kreditplattformen langfristig einen Auftrieb geben.
Fokus Volkswirtschaft
Digitalisierung und Innovationen gelten beide als wichtige Treiber von technologischem Fortschritt und Wachstum.Eine aktuelle Studie im Auftrag von KfW Research untersucht, wie Digitalisierung und Innovationen zusammenhängen. Die zentralen Ergebnisse hieraus sind:
- Digitalisierung und Innovation in Unternehmen hängen eng miteinander zusammen und bedingen sich gegenseitig.
- Unternehmen, die sowohl Digitalisierungs- als auch Innovationsvorhaben umsetzen, gehen ihre Digitalisierung tiefgreifender und umfassender an als andere Unternehmen.
- Diese Unternehmen wachsen schneller als ausschließliche Digitalisierer.
Die zu Grunde liegende Studie finden Sie hier: Zusammenhang zwischen der Durchführung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben im Mittelstand(PDF, 654 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Innovation
Weitere Informationen zum Thema Digitalisierung
Angesichts der deutlichen Entspannung der pandemischen Lage macht das mittelständische Geschäftsklima im Juni erneut einen ähnlich großen Sprung nach oben wie schon im Mai und schließt fast zu den Großunternehmen auf. Der Anstieg der Geschäftslageurteile ist der zweitstärkste seit Beginn der Zeitreihe im Januar 2005, gleichzeitig fallen die Erwartungen der Mittelständler so optimistisch aus wie nie in den vergangenen gut zehn Jahren. Nun ist es entscheidend mit den wiedergewonnenen Freiheiten verantwortungsvoll umzugehen und die Impfkampagne mit hohem Tempo weiterzufahren, gerade angesichts der immer mehr um sich greifenden sehr ansteckenden Delta-Variante des Virus.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juni 2021(PDF, 109 KB, nicht barrierefrei)
Corona-Krise bremst Innovationen im Mittelstand
Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren bei den Innovationsaktivitäten der mittelständischen Unternehmen. Nach einem kurzen Schub zu Beginn der Krise gehen die Innovationsanstrengungen im Mittelstand weiter zurück. Die zentralen Untersuchungsergebnisse sind:
- Drei von zehn mittelständischen Unternehmen verringern 2020 die Innovationstätigkeit.
- Finanzierung und Fachkräftemangel bleiben größte Hemmnisse.
- Innovatorenanteil im Mittelstand steigt 2019 aufgrund neuer OECD-Begriffsdefinition.
KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2020(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen auf der Themenseite Innovationen
Corona-Krise belastet Unternehmen – Finanzierungsklima trübt sich ein.
Die KfW Bankengruppe hat in Zusammenarbeit mit 18 Wirtschaftsverbänden zum 20. Mal eine Unternehmensbefragung zu Bankenverhalten und Finanzierung durchgeführt.
Die wichtigsten Ergebnisse sind:
- Die Finanzierungssituation der Unternehmen hat sich verschlechtert. Der Anteil der Unternehmen, der von Schwierigkeiten beim Kreditzugang berichtete, betrug 26,5 %.
- Rund 60 % der befragten Unternehmen haben im Jahr 2020 Kreditverhandlungen geführt. Insbesondere langfristige Kredite waren gefragt.
- Die Krise hat die finanzielle Situation der Unternehmen belastet. Dadurch sind auch die Ratingnoten unter Druck geraten – 34,5 % der Unternehmen meldeten eine Verschlechterung der Bonitätsbewertung.
- Etwa zwei Drittel der befragten Unternehmen haben 2020 Investitionen getätigt – im Vergleich zum Vorjahr aber in geringerem Umfang. Investitionspläne für 2021 deuten aber auf eine Erholung hin.
Unternehmensbefragung 2021(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Zur Themenseite Unternehmensbefragung
Fokus Volkswirtschaft
Der deutsche Mittelstand atmet auf – Mitte Mai war die Betroffenheit der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zwar noch immer hoch, im Vergleich zum Jahresbeginn dennoch rückläufig. Das zeigt die 5. Corona-Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels. Gegenwärtig haben rund 2,4 Mio. Unternehmen in Deutschland mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Eine deutliche Entspannung ist insbesondere bei der finanziellen Situation der Unternehmen sichtbar: Weniger Unternehmen meldeten Umsatzeinbußen, die Liquiditätsausstattung hat sich spürbar verbessert und auch die Eigenkapitalsituation der KMU stabilisiert sich. Als zunehmende Belastung für den Erholungskurs erweisen sich jedoch Störungen in den internationalen Liefer- und Wertschöpfungsketten. Betroffen sind davon vor allem mittelständische Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe.
Licht am Ende des Tunnels – die Lage im Mittelstand entspannt sich(PDF, 227 KB, nicht barrierefrei)
Zur Themenseite Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen
Die dritte Corona-Welle ist gebrochen, der Anteil der Geimpften steigt, in immer mehr Regionen bestehen Aussichten auf anhaltende Lockerungen des öffentlichen Lebens. Angesichts dieser guten Nachrichten hellt das Geschäftsklima in den mittelständischen Unternehmen im Mai rasant auf und ist erstmals seit Pandemiebeginn wieder positiv. Getragen wird der Anstieg vor allem von einem viel optimistischeren Blick auf die kommenden sechs Monate. Die Konjunkturampel springt auf Grün, Vorsicht beim Tritt aufs Gaspedal ist gleichwohl angezeigt. Mit zu raschen Lockerungen würde Deutschland nach wie vor riskieren, die jüngsten Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie wieder zu verspielen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Mai 2021(PDF, 101 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die Corona-Krise hat der Ausbildungsaktivität der KMU – und damit insgesamt - einen kräftigen Dämpfer verpasst: Im Jahr 2020 hat jedes vierte (26 %) ausbildende KMU aufgrund der Krise weniger neue Auszubildende eingestellt als ursprünglich geplant. Insgesamt wurden fast 50.000 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen als im Vorjahr (-9 %). Für die Zukunft der durch die Krise ausgebremsten Schulabsolventen sowie für die Wettbewerbsfähigkeit der KMU ist es wichtig, die nicht zustande gekommenen Ausbildungsverhältnisse möglichst schnell nachzuholen. Doch kurzfristig ist selbst die Rückkehr zum Vorkrisenniveau unwahrscheinlich.
Zur Themenseite Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen
Die dritte Corona-Welle hat vielerorts Verschärfungen des Lockdowns erfordert und bis zu einer Immunisierung der breiten Bevölkerung ist es noch ein langer Weg. Andererseits erholt sich die Weltwirtschaft spürbar. In diesem von widersprüchlichen Signalen geprägten Umfeld schlagen sich die mittelständischen Unternehmen wacker: Ihr Geschäftsklima nimmt im April das dritte Mal in Folge zu. Beide Klimakomponenten tragen zu dem Anstieg bei. Damit der erhoffte Aufschwung nun auch Realität wird, müssen die Neuinfektionen konsequent eingedämmt und das Impftempo weiter hochgefahren werden.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer April 2021(PDF, 61 KB, nicht barrierefrei)
Das Coronavirus trifft die exportorientierte deutsche Volkswirtschaft in einer ohnehin schwierigen Situation. Zunehmende Spannungen in den internationalen Handelsbeziehungen und eine sich eintrübende Weltkonjunktur wirkten auch in den Mittelstand hinein, der seine Auslandsumsätze im Jahr 2018 nur um rund 3,1 % auf 595 Mrd. EUR steigern konnte, im Vergleich zu 5,5 % im Jahr 2017. Im Jahr 2019 waren die KfW-ifo-Exporterwartungen des deutschen Mittelstands anhaltend negativ, bevor sie im März 2020 drastisch eingebrochen sind. Besonders betroffen sind die rund 800.000 auslandsaktiven Mittelständler von den Auswirkungen der Corona-Krise in Europa, denn dort liegen ihre wichtigsten Absatz- und Beschaffungsmärkte. Der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA rückt angesichts der Corona-Krise zwar in den Hintergrund – eine mögliche Eskalation erfüllt aber dennoch jeden dritten Mittelständler mit Sorge.
KfW-Internationalisierungsbericht 2021(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Zur Themenseite Deutschlands starke Verbindung zur Weltwirtschaft
Fokus Volkswirtschaft
Die betriebliche Weiterbildung wurde im Jahr 2020 durch die Corona-Krise hart ausgebremst, weil es vielen Unternehmen an Geld, Zeit und Planungssicherheit mangelt. Eine aktuelle Sondererhebung im KfW-Mittelstandspanel zeigt, dass fast 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen im vergangenen Jahr ihre Weiterbildungsaktivitäten reduziert haben, die Hälfte davon auf null. Der Weiterbildungsbedarf besteht jedoch in der Krise fort. Auf dem Gebiet der Digitalkompetenzen ist er im Jahr 2020 sogar kräftig gestiegen. Fehlende Digitalkompetenzen der Beschäftigten sind eine der größten Hürden des digitalen Strukturwandels – was den krisenbedingten Einbruch der Weiterbildung umso problematischer für die künftige Transformations- und Wettbewerbsfähigkeit macht.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Die Stimmung in den mittelständischen Unternehmen hellt im März zum zweiten Mal in Folge auf – und diesmal sogar ausgesprochen deutlich. Mit einsetzendem Frühling steigt das Geschäftsklima um gut das Dreifache einer üblichen Monatsveränderung. Besonders die Erwartungen springen regelrecht nach oben und sind erstmals seit Ausbruch der Pandemie leicht positiv. Noch besser gestimmt sind derzeit die Großunternehmen. Die kräftigen Klimaverbesserungen in der ganzen Breite der Wirtschaft sind angesichts der sich auftürmenden dritten Infektionswelle jedoch nur eine Momentaufnahme. Gleichwohl unterstreichen sie das große Potenzial für eine konjunkturelle Erholung, sobald die Pandemie erfolgreich eingedämmt wird – es sind Vorschusslorbeeren für den Aufschwung.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2021(PDF, 97 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Junge Selbstständige, die erst kurze Zeit am Markt sind, leiden unter der Corona-Krise besonders stark. Seit Ausbruch der Krise haben 40 % der befragten Selbstständigen mehr als die Hälfte ihrer Umsätze verloren. Aufgrund der coronabedingten Einbußen halten es 30 % der Befragten mindestens für wahrscheinlich ihre berufliche Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Ebenso viele mussten aufgrund der Krisenauswirkungen ihren Lebensstandard sehr stark einschränken. Anders als im etablierten Mittelstand hat die Krise bei den jungen Selbstständigen für Frauen häufiger negative Auswirkungen.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Rückgang der Digitalisierungsaktivitäten vor Corona, ambivalente Entwicklung während der Krise
Der aktuelle KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand untersucht die Entwicklung der Digitalisierungsaktivitäten vor und während der Corona-Pandemie. Das zentrale Ergebnis ist, dass sich die Digitalisierungsaktivitäten während der Krise ambivalent entwickeln:
- Zwar weitet ein Drittel der Mittelständler seine Digitalisierungsaktivitäten aus, allerdings führt auch ein Drittel nach wie vor keine Digitalisierungsprojekte durch.
- Zumeist werden schnell umsetzbare Maßnahmen zur Krisenbewältigung durchgeführt, langfristig und strategisch angelegte Vorhaben werden häufiger zurückgestellt.
- Vor allem große und FuE-treibende Mittelständler weiten ihre Aktivitäten aus: Eine Spaltung des Mittelstands droht.
KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2020(PDF, 937 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die Frauenquote im Mittelstand ist im vergangenen Jahr nur langsam gestiegen: Insgesamt hatten im Jahr 2020 rund 638.000 Frauen die Führung eines mittelständischen Unternehmens inne oder waren selbstständig. Der Anteil von Unternehmerinnen liegt damit aktuell bei 16,8 %. Das KfW-Mittelstandspanel zeigt darüber hinaus: Die Corona-Krise macht keinen Unterschied zwischen frauen- und männergeführten Unternehmen. Beide haben seit Beginn der Pandemie genauso häufig mit deren Auswirkungen zu kämpfen. Eventuell könnten in der Corona-Krise eingeführte flexiblere Arbeitsmodelle sogar den Pool potenzieller weiblicher Führungskräfte vergrößern. Das scheint auch nötig, denn dass die Führungsetagen des Mittelstands absehbar stärker weiblicher werden, ist wenig wahrscheinlich. Ursächlich ist dabei die eher zurückhaltende Gründungstätigkeit von Frauen. Eine Sogwirkung könnte auch die geplante gesetzliche Frauenquote für Großunternehmen entfalten. Der Gesetzentwurf dafür liegt vor.
Fokus Volkswirtschaft
Eine aktuelle Studie im Auftrag von KfW Research untersucht, welche Technologien in mittlerer Frist für Deutschland am Erfolg versprechendsten sind. Die zentralen Ergebnisse sind:
- Deutschland verfügt insgesamt über ein ausdifferenziertes Technologieprofil.
- Gute Ausgangspositionen bestehen insbesondere bei Kraftfahrzeugs-, Produktions- sowie Umwelt- und Klimaschutztechnologien.
- Es ist zwingend notwendig, das Kompetenzspektrum auf Informationstechnologien zu erweitern.
Während im Januar noch der verschärfte Lockdown verdaut werden musste, weht im Februar ein Hauch von Frühling. Das mittelständische Geschäftsklima steigt wieder deutlich um 4,2 Zähler auf -10,1 Saldenpunkte. Vor allem die Geschäftserwartungen hellen sich auf. Aber auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage legt etwas zu. Die Schere zwischen den von Eindämmungsmaßnahmen betroffenen Dienstleistungs- und Einzelhandelsunternehmen auf der einen Seite und den Bau- und Industrieunternehmen auf der anderen Seite bleibt aber weit geöffnet. Bei den mittelständischen Industrieunternehmen setzt sich der kräftige Stimmungsaufschwung fort. Im Einzelhandel ist es dagegen nur die Hoffnung auf bessere Zeiten, die im Februar für einen moderaten Anstieg des Geschäftsklimas sorgt. Die Lagebeurteilung des Einzelhandels ist dagegen fast so schlecht wie während des ersten Lockdowns.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2021(PDF, 145 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine Zukunftstechnologie mit hohem Wachstumspotenzial und den Qualitäten eines „Gamechangers“ in vielen Branchen. Aktuell ist sie im Mittelstand jedoch noch wenig verbreitet. Die hohe Konzentration auf FuE-treibende Mittelständler unterstreicht die hohen Anforderungen, die ihre Nutzung derzeit noch stellt.
Fokus Volkswirtschaft
Die berufliche Selbstständigkeit wird heutzutage häufig als Wagnis gesehen. Tatsächlich sind Selbstständige – insbesondere „frische“ Gründerinnen und Gründer – im Durchschnitt risikobereiter als der Rest der Erwerbsbevölkerung. Dabei sind Gründer deutlich risikobereiter als Gründerinnen. Das ist auf den höheren Nebenerwerbsanteil bei Gründerinnen zurückzuführen. Die zunehmende Unsicherheit des gesamtwirtschaftlichen Umfelds in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass weniger risikobereite Menschen das Interesse an einer Selbstständigkeit verloren haben. Der sinkende Gründungsgeist ist volkswirtschaftlich aber ein Problem. Es wäre klug, etwas zu unternehmen, um den Gründungsgeist wiederzubeleben. Unsicherheit bzw. Risiko kann jetzt schon für viele Selbstständige reduziert werden.
Volkswirtschaft Kompakt
Die meisten Deutschen sind Weiterbildungsmuffel. Das gilt gerade für Geringqualifizierte und Beschäftigte im Niedriglohnbereich. Der Trend steigt zwar, aber im Jahr 2018 nahmen 60 % der Erwerbspersonen nicht an betrieblicher Weiterbildung teil. Unter den Erwerbspersonen mit niedrigem Bildungsabschluss waren es sogar 75 %. Dies ist bedenklich, weil die Corona-Krise viele Arbeitsplätze gefährdet und der digitale, demografische und ökologische Strukturwandel die Anpassungsfähigkeit der Erwerbspersonen weit stärker fordert. Auch kann Weiterbildung den zunehmenden Fachkräfteengpässen entgegenwirken. Für eine Kultur lebenslangen Lernens gilt es daher, die Defizite bei Bildung und Weiterbildung zu beheben.
Alle Studien zum Thema Fachkräfte
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Mittelständisches Geschäftsklima: Einzelhandel im Sturzflug, Industrie stabil
Durch den verlängerten und verschärften Lockdown sinkt das mittelständische Geschäftsklima im Januar deutlich. Sowohl die Lagebeurteilungen als auch die Geschäftserwartungen gehen nach unten. Zum Pessimismus beitragen dürfte sowohl das unbestimmte Ende des Lockdowns als auch die Enttäuschung über den langsamen Impffortschritt. Das Stimmungsniveau insgesamt ist allerdings noch weit vom Rekordtief im vergangenen Frühjahr entfernt.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2021(PDF, 246 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Corona-Krise belastet den Mittelstand auch zu Beginn des Jahres 2021. Die Betroffenheit hat im Januar wieder zugenommen. Das zeigt die 4. Corona-Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels. Gegenwärtig haben rund 2,6 Mio. Unternehmen in Deutschland mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Im Vergleich zum Frühjahr 2020 ist die Lage aktuell aber weniger angespannt. Viele Unternehmen haben aus dem Vorjahr gelernt und mit Kreativität und Flexibilität Anpassungen bei ihren Geschäftsmodellen vorgenommen. Das zahlt sich jetzt aus. Umsatzeinbußen werden gegenwärtig als weniger drastisch eingeschätzt. Die Liquiditätsreserven vieler Unternehmen stehen weiter unter Druck, aber die Lage ist insgesamt noch stabil. Nicht zuletzt dürften sich auch die zahlreichen staatlichen Finanzhilfen als stützend erwiesen haben. Auch die Eigenkapitalausstattung hat sich nicht weiter verschlechtert. Eine Normalisierung der Geschäftslage erwarten viele KMU dennoch erst Ende des laufenden Jahres.
Fokus Volkswirtschaft
Mit der fortschreitenden Konsolidierung im deutschen Bankensektor und dem Filialrückbau geht ein schrittweiser Wandel in der Interaktion zwischen mittelständischen Unternehmen und Banken einher. Jüngste Daten des KfW-Mittelstandpanels zeigen dazu: Das Ausmaß der Filialnutzung hat im Mittelstand in den vergangenen Jahren merklich abgenommen. Im Jahr 2019 suchten rund 300.000 KMU weniger eine Filiale auf als noch 2017. Die Corona-Pandemie dürfte diese Entwicklung sowie die Hinwendung zu digitalen Kommunikationskanälen noch verschärft haben. Trotz geringerer Filialnutzung hat die Treue der Unternehmen zu ihrer „Hausbank“ aber nicht gelitten. Fast neun von zehn persönlichen Geschäftsterminen fanden bei Hausbanken statt. Die schnellstmögliche Verbindung zur nächsten Hausbankfiliale beträgt dabei für die mittelständischen Unternehmen deutschlandweit nur rund 15 Minuten. Auch Unternehmen in ländlichen Regionen sind weiterhin sehr gut an ihre regionalen Bankenmärkte angebunden.
Fokus Volkswirtschaft
Die Corona-Pandemie hat zwar für einen vordergründigen Innovations- und Digitalisierungsschub geführt. Mit zunehmender Krisendauer haben sich die Innovationsanstrengungen der Mittelständler jedoch rückläufig entwickelt. Dies droht bei einer längeren, weiteren Krisendauer auch für die Digitalisierungsanstrengungen. Insbesondere längerfristig und strategisch angelegte Projekte dürften aufgrund der angespannten finanziellen Situation häufig zurückgestellt oder zeitlich gestreckt werden.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Der Mittelstand zeigt sich in der ersten Dezemberhälfte noch relativ unbeeindruckt von steigenden Neuinfektionen und dem damit nahenden härteren Lockdown: Sein Geschäftsklima steigt um 1,4 Zähler auf -10,6 Saldenpunkte. Die Lageurteile verbessern sich merklich, während die Erwartungen des Mittelstands nur geringfügig zunehmen. Dabei dürften sich positive Aussichten auf eine mittelfristige Entspannung durch den Einsatz von effektiven Impfstoffen und eine trübere Sicht auf die nächsten Monate gegenseitig neutralisieren. Konkret waren die seit 16.12. geltenden Schließungen von Kitas, Schulen und vielen Geschäften im stationären Einzelhandel bis mindestens zum 10. Januar allerdings noch nicht bekannt, als ein Großteil der Antworten abgegeben wurde.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Dezember 2020(PDF, 92 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die im Frühjahr eingesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie haben weite Teile des deutschen Mittelstands schwer getroffen. Dennoch war das Verständnis der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) für die ergriffenen Maßnahmen hoch. Dies zeigen die Ergebnisse einer Anfang Juni durchgeführten Sonderbefragung von KfW Research. Mehr als die Hälfte der KMU stimmte der Aussage zu, dass die gesundheitlichen Folgen des Corona-Virus die vom Staat ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Schäden rechtfertigten. Der Zuspruch für die Maßnahmen hing jedoch merklich von der Betroffenheit der Unternehmen ab.
Bisher hohe Akzeptanz des Mittelstands für Corona-Maßnahmen(PDF, 162 KB, nicht barrierefrei)
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Fokus Volkswirtschaft
Die Unternehmen sind im Corona-Jahr 2020 plötzlich mit existenziellen Problemen beschäftigt und legen ihre Zukunftsplanung auf Eis – auch hinsichtlich der Übergabe an die nächste Generation. Daran liefert das Nachfolge-Monitoring von KfW Research eine positive Momentaufnahme. Erstens halten zumindest viele Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Rückzug kurz bevorsteht, auch in der Krise an ihren Übergabeplänen fest. Zweitens sind sie gut vorbereitet in die Krise gegangen und halten bereits laufende Nachfolgeprozesse auf Kurs: Knapp die Hälfte der ca. 260.000 für die kommenden zwei Jahre vorgesehenen Übergaben ist fertig verhandelt. Doch mit zunehmender Krisendauer steigt das Risiko gescheiterter Nachfolgen. Ein Grundproblem wird durch die Krise noch verschärft: Es mangelt wegen ungünstiger Demografie und schwachem Gründergeist an Nachwuchs. Der Abbau von Gründungshürden ist zentral für den Generationenwechsel im Mittelstand.
Fokus Volkswirtschaft
Die zunehmende wirtschaftspolitische Unsicherheit der vergangenen Jahre verdirbt die Gründungslust. Umso erfreulicher ist es, dass unter Jüngeren die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit wieder zugenommen hat, besonders unter Studierenden. Die Corona-Krise trieb die Unsicherheit aber auf neue Höhen. Der Gründungsgeist wird dadurch wohl wieder einen Dämpfer erhalten. Die wirksame Unterstützung der durch die Krise betroffenen Selbstständigen und Unternehmen kann aber helfen, dass es hoffentlich nur ein vorübergehender Dämpfer sein wird.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Die zweite Infektionswelle und der partielle Lockdown hinterlassen Spuren bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Das mittelständische Geschäftsklima fällt im November um 4,5 Zähler – ein markanter Rückgang aber doch nur moderat im Vergleich zu den Abstürzen im März und April. Relativ stabil zeigen sich die Lageurteile, dagegen fallen die Geschäftserwartungen deutlich. Die Dienstleistungsunternehmen sind aktuell in beiden Größenklassen das am schlechtesten gestimmte Segment. Schließlich beinhaltet die Gruppierung diejenigen Branchen, die seit Anfang November direkt von einem Lockdown betroffen sind. Insbesondere dürften die kritischen Branchen unter den kleinen und mittleren Dienstleistern stark repräsentiert sein. Eine rapide Verschlechterung des Geschäftsklimas verzeichnen aber auch die mittelständischen Einzelhändler. Bei den Großunternehmen kann die Industrie die Stimmung insgesamt retten.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer November 2020(PDF, 94 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Betroffenheit und die Verunsicherung durch die Covid-19-Pandemie in Deutschlands Unternehmen ist groß. Zwar steht die Breite der Unternehmen auf einem soliden finanziellen Fundament. Allerdings erschwert die derzeitige Lage den Unternehmen, die notwendigen Investitionen zu tätigen, um Wachstumsfelder aus der Transformation hin zu einer digitalen und klimaneutralen Wirtschaft zu erschließen. Diese sind aber besonders wichtig, um aus der Verschuldung herauszuwachsen und Wohlstand in der Zukunft zu sichern. Schon jetzt hat die Corona-Krise im Mittelstand massiv Investitionspläne platzen lassen. Die Unternehmen erwarten fast 40 Mrd. weniger Investitionen als im Vorjahr. Deshalb ist jetzt auch die Wirtschaftspolitik gefragt, Rahmenbedingungen zu schaffen, Anreize zu setzen für Investitionen, und mit Anschubfinanzierungen in Vorlage zu treten, um dadurch künftiges Wachstum in diesen beiden Schlüsselfeldern zu ermöglichen.
Zur Themenseite Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Volkswirtschaft Kompakt
Gründungen durch Migrantinnen und Migranten spielen wieder eine wichtigere Rolle für die Gründungstätigkeit in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich ihr Anteil an allen Existenzgründungen 2019 deutlich um 3 Prozentpunkte auf 26 %. Schlechtere Arbeitsmarktchancen, eine höhere Risikobereitschaft sowie eine stärkere Wirkung von Rollenvorbildern führen zu einer im Vergleich zur Gesamtbevölkerung größeren Gründungsneigung. Von den 605.000 Existenzgründungen des Jahres 2019 wurden dementsprechend 160.000 von Migrantinnen und Migranten realisiert.
Wieder mehr migrantische Gründungen(PDF, 103 KB, nicht barrierefrei)
Angesichts der zweiten Infektionswelle trüben sich die Aussichten der mittelständischen Unternehmen ein. Zwar wurde die Geschäftstätigkeit durch die im Oktober noch milden und überwiegend lokal begrenzten Eindämmungsmaßnahmen kaum gestört, da die Neuinfektionen aber rasant steigen, waren härtere Einschnitte absehbar. Der partielle Lockdown im November wird den Konjunkturaufschwung unterbrechen. Durch das Eingreifen sind allerdings die Chancen gut, dass sich die Schäden auf die besonders kontaktintensiven Wirtschaftsbereiche reduzieren lassen. Der Winter ist allerdings noch lang und die Abwärtsrisiken daher groß.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Oktober 2020(PDF, 97 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Viele mittelständische Unternehmen nutzen digitale Plattformen. Dies zeigt, dass viele Unternehmen die Vorteile von Plattformen für ihr Unternehmen erkannt haben und die Hürden für deren Nutzung nicht allzu hoch gesteckt sind. Vorreiter sind große Mittelständler sowie Unternehmen aus den wissensbasierten Dienstleistungsbranchen und dem FuE-intensiven Verarbeitenden Gewerbe. Außerdem zeigt sich, dass junge Unternehmen sowie Unternehmen mit einem hohen Anteil an jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern häufig auf digitalen Plattformen aktiv sind.
Welche Mittelständler nutzen digitale Plattformen? (PDF, 210 KB, nicht barrierefrei)
Die Corona-Krise hinterlässt im Mittelstand tiefe Spuren. Die Betroffenheit ist noch immer hoch und die Erwartungen für das Gesamtjahr 2020 historisch schlecht – dies zeigt das KfW-Mittelstandspanel 2020. Die Umsätze der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dürften stärker einbrechen als in der Finanzkrise 2009. In der Folge befürchten viele Unternehmen einen weiteren erheblichen Druck auf die Beschäftigung. Auch die Eigenkapitalquoten leiden. Allerdings verfügt der Mittelstand in der Breite über ein solides Fundament. Dazu beigetragen hat auch die erneut gute Performance der KMU im Jahr 2019. Beschäftigung, Umsätze und Investitionen legten im vergangenen Jahr abermals zu. Der Mittelstand konnte seine Profitabilität steigern und sein finanzielles Polster noch einmal ausbauen. Die Ausgangslage der KMU war somit sehr gut. Aber der Weg aus der Krise dürfte lang und steinig werden und die Folgen noch lange nachwirken.
Der ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit wurde aktuell extern evaluiert. Wie die Evaluierung bestätigt, setzt das Programm an den zentralen Hemmnissen an und trägt dazu bei, die Innovationspotenziale mittelständischer Unternehmen in Wachstum umzusetzen. Von der Förderung gehen messbare positive Effekte auf die Innovations- und Investitionsausgaben sowie auf das Beschäftigten- und Umsatzwachstum aus, wie mithilfe eines modernen statistischen Verfahrens ermittelt werden konnte. Außerdem zeichnet sich die Förderung durch eine hohe Effizienz aus. Eine Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse finden Sie hier:
ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit positiv evaluiert (PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Start-ups in Deutschland stabil bei 70.000 im Jahr 2019 – Auswirkung der Corona-Krise unsicher
Der Bestand an innovations- oder wachstumsorientierten jungen Unternehmen in Deutschland hat sich stabilisiert. Nach den Anstiegen in den Jahren 2017 und 2018 verharrt die Zahl der Start-ups im Jahr 2019 bei 70.000. Wie sich die Corona-Krise auf die Zahl der Start-ups 2020 auswirken wird ist unsicher. Neben mehr Unternehmensschließungen und weniger Gründungen dürfte es eine Verschiebung zu stärker internetbasierten und digitalen Geschäftsmodellen geben. Zur Finanzierung ihres künftigen Wachstums wollen ein Fünftel der Start-up-Gründerinnen und -Gründer auf Venture Capital zurückgreifen. Das sind doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Der Wunsch nach VC steigt also.
Eine zweite Welle von Corona-Neuinfektionen baut sich in Europa auf und nimmt in einigen Nachbarländern bereits bedenkliche Ausmaße an – eine Gefahr für die wirtschaftliche Erholung. Vor diesem Hintergrund sendet der inzwischen fünfte Anstieg des Geschäftsklimas im deutschen Mittelstand ein Signal der Beruhigung. Die sich wieder verschärfende Pandemie wird gleichwohl zu einer wachsenden Hürde für die Konjunktur am Anfang der kalten Jahreszeit. Noch kann sie übersprungen werden, doch der schwierige Teil der Erholung beginnt.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer September 2020(PDF, 90 KB, nicht barrierefrei)
VC-Markt in Deutschland: Reif für den nächsten Entwicklungsschritt
Der Markt für Venture Capital befindet sich in Deutschland seit einigen Jahren im Aufwind: Seit 2014 sind die jährlichen VC-Investitionen von 0,7 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR gestiegen. Dennoch fällt der deutsche VC-Markt im internationalen Vergleich weiter zurück, denn gemessen an der Wirtschaftskraft haben sich die VC-Märkte in anderen Ländern deutlich besser entwickelt. Um zum europäischen Champion Großbritannien aufzuschließen, müssten deutsche Start-ups jährlich etwa doppelt so viel Venture Capital erhalten, um das französische Level zu erreichen, um über ein Drittel mehr.
Größere Finanzierungsrunden sind eine besondere Herausforderung für den deutschen VC-Markt: An 9 von 10 solcher Finanzierungsrunden sind ausländische Investoren beteiligt. Für das deutsche VC-Ökosystem erhöht dies das Abwanderungsrisiko der finanzierten Start-ups.
Anteil der Digitalisierungsplaner stagniert auf hohem Niveau
Zum 4. Mal hat die KfW Bankengruppe in Zusammenarbeit mit 19 Wirtschaftsverbänden die Unternehmen zu ihren Digitalisierungsaktivitäten befragt. Die wichtigsten Ergebnisse sind:
- Der positive Trend der vergangenen Jahre zu mehr Digitalisierungsplanern hat sich in der aktuellen Befragung nicht fortgesetzt. Die Corona-Pandemie dürfte der Digitalisierung jedoch neuen Schub verleihen.
- Vorreiter der Digitalisierung sind große Unternehmen sowie Unternehmen des Groß- und Außenhandels.
- Das Ergreifen von Chancen ist unverändert das wichtigste Motiv für die Digitalisierung. Der Druck aus dem Unternehmensumfeld hin zur Digitalisierung nimmt jedoch deutlich zu.
Unternehmensbefragung 2020 – Digitalisierung(PDF, 654 KB, nicht barrierefrei)
Die Wirtschaftskrise infolge des Corona-Schocks ist einzigartig in der Schnelligkeit ihrer Ausbreitung, ihrer Tiefe und ihrem weltweiten Ausmaß. Eine nachhaltige Erholung ist aufgrund der hohen Unsicherheit besonders schwierig und hängt wesentlich von der Bewältigung drei zentraler Herausforderungen ab: Erstens ist mit einer steigenden Verschuldung des Unternehmenssektors zu rechnen, die sich negativ auf die Investitionstätigkeit auswirkt. Hinzu kommt, dass hohe Kreditausfälle und geringe Erträge die Eigenkapitalpositionen der Banken und damit das Kreditangebot zunehmend belasten. Zweitens hat die Corona-Pandemie die Umsetzung kurzfristiger Digitalisierungs- und Innovationsprojekte beschleunigt. Langfristigere, tiegreifendere Vorhaben laufen jedoch Gefahr, aufgrund fehlender Mittel zurückgestellt zu werden. Drittens erfordert der Klimawandel strukturelle Anpassungen in allen Wirtschaftsbereichen, die ungeachtet finanzieller Engpässe rasch und entschlossen angegangen werden müssen.
Wie weiter? Worauf es in der Corona-Krise jetzt ankommt(PDF, 180 KB, nicht barrierefrei)
Zur Themenseite Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Die von den Lockerungen der Corona-Einschränkungen ab Mai getriebene, zunächst sehr kräftige Stimmungserholung flaut ab. Im August hellt das mittelständische Geschäftsklima zwar weiter auf, aber deutlich weniger stark als in den Monaten davor; das Vorkrisenniveau vom Februar bleibt noch ein gutes Stück entfernt. Erstmals seit gut zweieinhalb Jahren sind die Großunternehmen wieder geringfügig besser gestimmt als die Mittelständler. Der leichte Teil der Erholung seit dem historischen Absturz der Wirtschaftsaktivität im April ist vorbei, die weitere Annäherung an das Vorkrisenniveau im nahenden Herbst und Winter wird im Vergleich dazu wohl eher zäh.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer August 2020(PDF, 173 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Immer mehr Mittelständler nutzen Social Media – auch zur Gewinnung von Mitarbeitern. Aktuell setzen rund 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland Social Media für die Rekrutierung ein, im europäischen Durchschnitt sind es sogar 46 %. Dies zeigen die Ergebnisse der European SME Survey, für die die KfW gemeinsam mit anderen europäischen Förderbanken mehr als 2.500 Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich befragt hat.
Vor allem Unternehmen, die stark vom Fachkräftemangel betroffen sind, greifen auf soziale Netzwerke zurück. Diese werden als Werkzeug zur Mitarbeiterrekrutierung auch deshalb immer wichtiger, weil zunehmend Jahrgänge in den Arbeitsmarkt eintreten, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind. Die Corona-Krise hat der Social Media-Nutzung weiteren Auftrieb verliehen – und dürfte diese mittelfristig auch im Mittelstand befördern.
Im Juli ist das mittelständische Geschäftsklima zum dritten Mal in Folge angestiegen. Das zeigt, dass den kleinen und mittleren Unternehmen der Neustart nach der Eindämmung der ersten Infektionswelle recht gut gelungen ist. Auf einem soliden Erholungskurs geht es ins Sommerquartal. Positiv ist vor allem, dass sich auch die Lageurteile verbessern. Der Gegenwind nimmt aber zu. Insbesondere der exportorientierten Industrie schadet die global weiterhin hohe Infektionsdynamik. Die neuerdings auch hier zu Lande wieder gestiegenen Neuinfektionen sind außerdem ein Risiko für fast alle Branchen.
Finanzierungsklima: Unternehmen gut gerüstet vor der Krise
Die KfW Bankengruppe hat in Zusammenarbeit mit 19 Wirtschaftsverbänden zum 19. Mal eine Unternehmensbefragung zu Bankenverhalten und Finanzierung durchgeführt.
Die wichtigsten Ergebnisse sind:
- Das Finanzierungsklima war bis zum Ausbruch der Corona-Krise unverändert gut.
- Der Anteil der Unternehmen, der von Schwierigkeiten beim Kreditzugang berichtete, betrug 13,4 %.
- Kleine Unternehmen haben jedoch nach wie vor deutlich größere Schwierigkeiten beim Kreditzugang.
- Der Positivtrend bei Eigenkapitalquoten und Bonitätsbewertung hat sich bis Anfang 2020 fortgesetzt.
- Bankkredite bleiben eine bedeutende Finanzierungsquelle der Unternehmen. Die mit Abstand wichtigste Rolle in der Unternehmensfinanzierung spielt jedoch weiterhin die Innenfinanzierung.
Unternehmensbefragung 2020 – Kreditzugang(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Viele mittelständische Unternehmen reagieren mit Innovationen auf die Corona-Krise: 27 % haben aufgrund der Krise bereits Prozess-, Produkt- oder Geschäftsmodellinnovationen eingeführt. Zusammen mit jenen Unternehmen, die dies noch planen, beträgt dieser Wert sogar 43 %. Vor allem Unternehmen, die starke Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten, zählen dazu. Allerdings handelt es sich bei den Innovationen häufig um adhoc umsetzbare Maßnahmen und seltener um die Ergebnisse längerfristiger Entwicklungsprozesse.
Innovationen in der Corona-Krise: Not macht erfinderisch(PDF, 161 KB, nicht barrierefrei)
Die geringe Zahl der Neuinfizierten, die dadurch ermöglichten Lockerungen bei den Eindämmungsmaßnahmen sowie die kräftigen wirtschaftspolitischen Impulse treiben das Geschäftsklima der Mittelständler zu Sommerbeginn rasant nach oben. Die zurückkehrende Zuversicht ist angesichts der umfassenden Stabilisierungsmaßnahmen und der Erfolge bei der Viruseindämmung zwar fundiert. Wegen der kaum vorhersehbaren weiteren Pandemieentwicklung sind aber auch die Risiken nach wie vor sehr hoch.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Juni 2020(PDF, 169 KB, nicht barrierefrei)
Gestützt durch die Entwicklung von Konjunktur und Arbeitsmarkt konnte die Gründungstätigkeit in Deutschland 2019 erstmals seit Jahren wieder anziehen. Die Zahl der Existenzgründungen ist auf 605.000 gestiegen (+58.000). Maßgeblich dafür war ein deutliches Plus bei den Nebenerwerbsgründungen, bei den Vollerwerbsgründungen ging es dagegen abwärts auf einen neuen Tiefpunkt. Dabei konnte die Zahl der Chancengründungen auf 439.000 überproportional zulegen. Auch internetbasierte und digitale Gründungen gab es deutlich mehr. Der Ausblick für die Gründungstätigkeit 2020 war positiv – die Corona-Pandemie verändert aber einiges. Viele Gründungspläne, von denen es erneut mehr gab, dürften nun verschoben werden. Allerdings sind krisenbedingt mehr Notgründungen zu erwarten.
KfW-Gründungsmonitor 2020(PDF, 643 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Seit der Jahrtausendwende sind die Eigenkapitalquoten (EKQ) im Mittelstand fast kontinuierlich gestiegen. Die Corona-Krise hat diesen Trend nun zum Halten gebracht. Ergebnisse einer aktuellen Sonderbefragung von KfW Research zeigen: Bereits Anfang Juni gingen rund 29 % der Mittelständler davon aus, dass ihre EKQ im laufenden Geschäftsjahr sinken werden. Verzeichneten die Unternehmen im Mai coronabedingte Umsatzverluste, liegt der Anteil sogar bei 41 %. Rund vier von zehn KMU rechnen dagegen mit einer gleich bleibenden EKQ im Jahr 2020. Lediglich 6 % glauben an eine Verbesserung. Besonders auffällig: KMU mit Negativ-Erwartungen hatten mit einer durchschnittlichen EKQ von 23,7 % bereits vor der Krise ein dünnes Kapitalpolster (Vergleich Mittelstand gesamt: 31,2 %). Eine weitere Verschlechterung ihrer EKQ erhöht für sie die Gefahr einer Überschuldung und Insolvenz.
Fokus Volkswirtschaft
Die dunklen Corona-Wolken lichten sich allmählich. Der Großteil des Mittelstands wird die Folgen der Corona-Krise dennoch lange spüren. Dies zeigt die zweite repräsentative Sonderbefragung auf Basis des KfW-Mittelstandspanels von Anfang Juni 2020. Eine Rückkehr zu voller Wirtschaftsaktivität erwarten die meisten Unternehmen nicht vor Frühjahr 2021. Rund 2,3 Mio. Mittelständler waren auch im Mai von Umsatzeinbrüchen betroffen. Durchschnittlich 46 % der üblicherweise zu erwartenden Umsätze gingen verloren. Insgesamt büßte der Mittelstand im Mai rund 88 Mrd. EUR ein. Dies belastet auch die Liquidität der Unternehmen. Zwar scheint sich die Situation für einige entspannt zu haben – so berichten 25 % der Mittelständler aktuell über ausreichend Liquiditätsreserven. Bei rund jedem fünften Unternehmen reichen die liquiden Mittel jedoch nur noch bis zu vier Wochen – wenn sich an der derzeitigen Situation nichts ändert.
Volkswirtschaft Kompakt
Die Corona-Pandemie führt nicht nur zu Nachfragerückgängen im Mittelstand, sondern auch zu Mitarbeiterausfällen durch Krankheit, Quarantäne oder Betreuungsengpässe. Eine Sondererhebung zum KfW Mittelstandspanel zeigt, dass es dadurch bei jedem vierten Mittelständler zu Störungen im Geschäftsbetrieb kommt.
Um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Mitarbeiter zu schützen, setzen viele Mittelständler verstärkt auf flexibles und digitales Arbeiten. Mehr als ein Drittel der Unternehmen hat die Möglichkeiten für Homeoffice ausgebaut, fast die Hälfte führt verstärkt Video- oder Telefonkonferenzen durch. Rund 15 % der Mittelständler wollen auch nach der Krise am Arbeiten von zu Hause festhalten.
Corona-Krise stärkt flexibles und digitales Arbeiten im Mittelstand(PDF, 97 KB, nicht barrierefrei)
Die Corona-Pandemie verursacht nie dagewesene Stimmungsschwankungen im Mittelstand. Sein Geschäftsklima erholt sich im Mai extrem stark, nachdem es zuvor historisch abgestürzt war. Bemerkenswert sind jedoch die Relationen. Die Klimaaufhellung gegenüber dem Vormonat ist zwar die zweitstärkste seit Beginn der Zeitreihe, macht aber nur gut ein Fünftel der Einbrüche im März und April wieder wett. Getragen wird die Verbesserung des Klimas allein von einem Rekordanstieg der – gleichwohl weiterhin sehr pessimistischen – Geschäftserwartungen.
Ein Seufzer der Erleichterung!(PDF, 112 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Viele mittelständische Unternehmen reagieren kreativ auf die Corona-Krise. Rund 43 % haben ihr Produkt-/Dienstleistungsangebot, ihren Vertrieb oder ihr Geschäftsmodell angepasst. Zusammen mit jenen Unternehmen, die dies noch planen, beträgt dieser Wert sogar 57 %. Vorreiter sind dabei Unternehmen aus von der Krise besonders betroffenen Branchen sowie Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit Innovationen hervorgebracht haben.
Mittelstand reagiert ideenreich auf Corona-Krise(PDF, 167 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Dem Druck der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt kann sich auch die Berufsausbildung in Deutschland nicht entziehen: Leiden die Ausbildungsbetriebe, hat das Folgen für das Angebot an Ausbildungs- und Übernahmekapazitäten für Absolventen. Gerade mit Blick auf die Fachkräftesituation in Deutschland gilt es deshalb, den aktuellen Krisenschock nicht auf die Berufsbildung durchschlagen zu lassen. Deutschland braucht gut ausgebildete Fachkräfte, je eher desto besser. Eine „verlorene Generation“ an Absolventen kann und darf man sich nicht leisten.
Das mittelständische Geschäftsklima ist weiterhin im freien Fall, es sinkt im April noch stärker als im März. Damit ist die Stimmung nun schlechter als vor elf Jahren im Tiefpunkt der Finanzkrise. Beide Teilindikatoren fallen mit neuen Negativrekorden auf: Die Geschäftslageurteile verschlechtern sich so stark wie noch nie, die Geschäftserwartungen stürzen auf einen neuen historischen Tiefpunkt. Gleichwohl sind wir zuversichtlich, im April das Stimmungstief gesehen zu haben – dank des umfassenden Corona-Schutzschirms, der Erfolge bei der Zurückdrängung der Virus-Infektionen und der nun angekündigten oder bereits umgesetzten Lockerungen.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer April 2020(PDF, 127 KB, nicht barrierefrei)
Digitalisierungsprojekte zunehmend im Mittelstand verbreitet, Digitalisierungsausgaben jedoch seit Jahren unverändert niedrig
Die wichtigsten Ergebnisse sind:
- 40 % der Unternehmen mit abgeschlossenen Digitalisierungsprojekten.
- Gesamtinvestment bei 19 Mrd. EUR pro Jahr.
- Durchschnittliche Digitalausgaben bei 17.000 EUR pro Unternehmen.
- Corona-Krise wird Digitalisierung beschleunigen.
KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2019(PDF, 895 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Corona-Krise hat den Mittelstand absehbar mit Wucht getroffen. Eine aktuelle Sonderbefragung auf Basis des KfW-Mittelstandspanels zeigt das Ausmaß der Betroffenheit: Über 2,2 Mio. kleine und mittlere Unternehmen verzeichneten im März Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Folgen. Durchschnittlich etwas über der Hälfte der üblicherweise im März zu erwartenden Umsätze gehen verloren. Insgesamt büßt der Mittelstand allein im März ca. 75 Mrd. EUR ein. Dennoch ist die Widerstandsfähigkeit im Mittelstand gegenüber derartigen Krisen hoch, dank stetig verbesserter Eigenkapitalausstattung und aufgebauter Finanzpolster. Das hilft vielen Unternehmen in der aktuellen Krise Verluste temporär zu verkraften und den Druck auf die Liquidität zu mindern. Bei andauerndem Lockdown allerdings würden die Verluste höher ausfallen als bislang. Die Liquiditätsreserven reichen dann bei der Hälfte der Unternehmen noch bis Ende Mai.
Das Coronavirus trifft die exportorientierte deutsche Volkswirtschaft in einer ohnehin schwierigen Situation. Zunehmende Spannungen in den internationalen Handelsbeziehungen und eine sich eintrübende Weltkonjunktur wirkten auch in den Mittelstand hinein, der seine Auslandsumsätze im Jahr 2018 nur um rund 3,1 % auf 595 Mrd. EUR steigern konnte, im Vergleich zu 5,5 % im Jahr 2017. Im Jahr 2019 waren die KfW-ifo-Exporterwartungen des deutschen Mittelstands anhaltend negativ, bevor sie im März 2020 drastisch eingebrochen sind. Besonders betroffen sind die rund 800.000 auslandsaktiven Mittelständler von den Auswirkungen der Corona-Krise in Europa, denn dort liegen ihre wichtigsten Absatz- und Beschaffungsmärkte. Der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA rückt angesichts der Corona-Krise zwar in den Hintergrund – eine mögliche Eskalation erfüllt aber dennoch jeden dritten Mittelständler mit Sorge.
KfW-Internationalisierungsbericht 2020(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Das mittelständische Geschäftsklima erfährt im Angesicht der Corona-Krise einen historisch einmaligen Absturz. Mit einem Minus von 20 Zählern wird der bisher schärfste Rückgang in der Finanzkrise um ein Vielfaches übertroffen. Anders als bei vorausgegangenen Rezessionen erfolgt der Einbruch nicht primär durch die eher zyklischen Industriebranchen, sondern es wurden viele Teile der Binnenwirtschaft bewusst stillgelegt. Dementsprechend rauscht das Geschäftsklima der mittelständischen Dienstleister sowie Einzel- und Großhändler besonders rasant in den Keller. Dennoch wird das Ausmaß der Krise erst zum Teil erfasst. Im Befragungszeitraum hat sich eine Verschärfung der Pandemie und der damit notwendigen Einschränkungsmaßnahmen zwar abgezeichnet, diese waren in Deutschland aber überwiegend noch nicht in Kraft. Die vollen Auswirkungen dürften also erst im April abgebildet werden.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer März 2020(PDF, 133 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Erschweren besondere Merkmale von Digitalisierungsvorhaben die externe Finanzierung solcher Projekte? Um diese Frage zu klären, vergleicht diese Untersuchung die Finanzierungsstruktur von Digitalisierungsvorhaben mit jener von Investitionen mithilfe eines statistischen Verfahrens aus der Evaluationsforschung.
Es zeigt sich, dass sich die Finanzierungsstruktur beider Vorhabensarten deutlich unterscheidet – selbst wenn Unternehmen miteinander verglichen werden, die hinsichtlich ihrer Größe, ihres Alters, ihrer Bonitätsbeurteilung und des jeweiligen Projektumfangs ähnlich aufgestellt sind. Dies deutet darauf hin, dass besondere Projektmerkmale von Digitalisierungsvorhaben einer Finanzierung mit Bankkrediten entgegenstehen.
Im Februar zeigten sich die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland nicht von dem zu diesem Zeitpunkt noch weitestgehend auf China begrenzten Corona-Virus beeindruckt: Nach einem Dämpfer im Vormonat ist das mittelständische Geschäftsklima wieder leicht angestiegen, wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Ursächlich für die Klimaverbesserung ist eine Aufhellung der Erwartungen. Anzeichen für einen Corona-Effekt gibt es hingegen bereits bei den Großunternehmen, deren Geschäftsklima erstmalig seit Oktober 2020 wieder einen Rückschlag erlebt.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Februar 2020(PDF, 126 KB, nicht barrierefrei)
Innovatorenquote sinkt auf 19 %
Die Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf den tiefsten Stand, der bislang mit dem KfW-Mittelstandspanel gemessen wurde. Seit 2006 ist der Anteil der Innovatoren bei Mittelständlern aller Größenklassen und aller Branchen zurückgegangen. Der Verlust an Innovatoren betrifft sowohl Unternehmen, die Marktneuheiten hervorbringen, als auch die breite Masse der nachahmenden Innovatoren. Die Innovationsausgaben entwickeln sich in der mittleren Frist ohne klaren Trend. Die Innovationsanstrengungen konzentrieren sich somit auf immer weniger Unternehmen.
Um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sicherzustellen, bedarf es einer Innovationspolitik, die zwei Stränge verfolgt: Einerseits muss die Forschung und Entwicklung (FuE) neuer Technologien gefördert werden. Andererseits bedarf es der Unterstützung der Innovationsaktivitäten von Unternehmen ohne FuE, die durch Maßnahmen der FuE-Förderung nicht erreicht werden können.
KfW-Innovationsbericht Mittelstand 2019(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt für die Fachkräftesicherung eine zentrale Rolle – auch im deutschen Mittelstand. Zwei von drei kleinen und mittleren Unternehmen haben bereits konkrete Maßnahmen umgesetzt, um familienfreundlichere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wissensintensive Industrie- und Dienstleistungsunternehmen führen das Feld an und sind vielfach optimistisch, dass die Digitalisierung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter erleichtern wird.
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice gehören im Mittelstand zu den am häufigsten umgesetzten Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bisher eher selten ist Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen. Kleine und mittlere Unternehmen, die konkrete Maßnahmen umgesetzt haben, zeigen häufiger eine hohe Wachstumsorientierung und sehen sich durch mehr Familienfreundlichkeit im Wettbewerb um Fachkräfte im Vorteil.
Das Jahr 2020 beginnt für die kleinen und mittleren Unternehmen mit einem Rückschlag: Ihr Geschäftsklima sinkt im Januar auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Ursächlich hierfür sind ausschließlich die zuletzt wieder pessimistischeren Erwartungen. Deutliche Lebenszeichen kommen hingegen von den Großunternehmen. Der positive Trend bei den großen Unternehmen spiegelt die Entspannung in den außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, während die Binnenwirtschaft ihre bislang verlässlich hohe Drehzahl etwas herunterfährt. Das Corona-Virus kommt aktuell als neuer Belastungsfaktor hinzu. Alles in allem bleibt die wirtschaftliche Dynamik vorerst verhalten.
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Januar 2020(PDF, 135 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Ein Drittel der KMU kann seinen Bedarf an Digitalkompetenzen nicht decken. Das Problem betrifft sowohl digitale Grundkompetenzen wie z. B. die Bedienung von Standardsoftware und digitalen Endgeräten als auch fortgeschrittene Kompetenzen wie Programmieren und statistische Datenanalyse. Die meisten KMU versuchen Digitalkompetenzen durch Weiterbildung aufzubauen. Allerdings dominieren kurze Weiterbildungsmaßnahmen mit oft begrenzter Qualifikationswirkung. Intensiverer Weiterbildung stehen vor allem finanzielle Hürden im Weg: Ein Drittel der KMU bezeichnet die direkten Kosten als Problem, ein Viertel den Arbeitsausfall abwesender Mitarbeiter. Digitale Lernformate ermöglichen flexibleres Lernen und haben deshalb das Potenzial, die berufliche Weiterbildung im Mittelstand künftig zu beleben.
Die Zahl innovations- oder wachstumsorientierter junger Unternehmen in Deutschland ist erneut gestiegen. Im Jahr 2018 gab es 70.000 Start-ups nach 60.000 im Jahr zuvor.
Im Schnitt weisen 9 von 100 Existenzgründungen von Männern Start-up-Merkmale auf, bei Frauen sind es nur 3 von 100. Die größten Unterschiede zwischen Gründungen von Frauen und Männern gibt es bei den Merkmalen der Innovations- und Wachstumsorientierung. Geeignete Maßnahmen, um die Gender-Lücke zu verringern, sind beispielsweise Frauen noch stärker für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu gewinnen oder unternehmerische Kenntnisse bereits in der Schule zu vermitteln.
Der Anteil von Frauen in den Chefetagen des Mittelstands hat seine Talfahrt vorerst beendet und ist zuletzt leicht gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels. Im Jahr 2018 wurden 16,1 % der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland von einer Frau an der Spitze geführt. Etwa 85 % der Inhaberinnen führt ein Dienstleistungsunternehmen. Auftrieb hat dem Chefinnenanteil dabei der jüngste Zuwachs bei Existenzgründungen durch Frauen gegeben. Insgesamt sitzt bei rund 613.000 Mittelständlern derzeit eine Frau im Chefsessel.



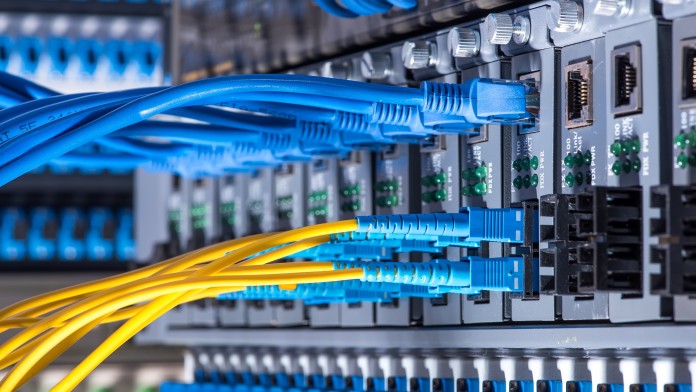
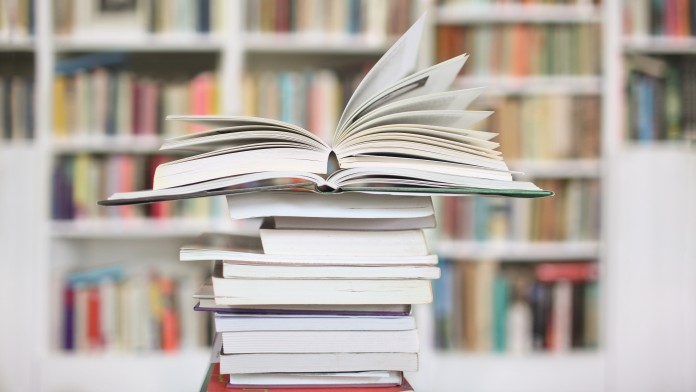
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: kfw.de/s/dekBbrjT
Link kopieren Link kopiert