
KfW Research
Demografie und BildungKfW Research Chartbook
Das deutsche Wirtschaftswachstum ließ während der vergangenen fünf Jahrzehnte im Trend immer weiter nach und ist in der ersten Hälfte der 2020er-Jahre sogar ganz zum Erliegen gekommen. Vorausblickend setzt die Verrentung der Babyboomer den Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck. Eine Rückkehr zu einem durchschnittlichen Wachstum von 1 %, wie im Koalitionsvertrag als Mindestanspruch formuliert, ist realistisch, aber auch ambitioniert. Hierzu bedarf es gleichzeitiger substanzieller Fortschritte in allen für das Wachstum relevanten Bereichen.
Deutschland im Wachstumstief: Wie weiter?(PDF, 2 MB, barrierefrei)
Weitere Informationen im Dossier Konjunktur
Fokus Volkswirtschaft
Ältere Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland investieren seltener als ihre jüngeren Pendants. Dies zeigen Auswertungen auf Basis des KfW-Mittelstandspanels. Diese Investitionslücke ist aber kein neues Phänomen: Seit über zwanzig Jahren investieren Unternehmen mit unter 40-jährigen Inhabern im Durchschnitt 20 Prozentpunkte häufiger als Unternehmen mit über 60-jährigen Inhabern. Zunehmend problematisch ist dies allerdings wegen der demografischen Entwicklung: Die Gruppe der älteren Unternehmerinnen und Unternehmer wird immer größer während der Nachwuchs fehlt. Der bremsende Effekt auf die Investitionen im Mittelstand nimmt in der Gesamtsicht daher zu. Mit Blick auf die Sicherung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit und auf die Investitionsbedarfe, die sich aus der dualen Transformation für den Unternehmenssektor ergeben, sind dies wenig erbauliche Entwicklungen.
Alterung: unterschätztes Hemmnis von Investitionen im Mittelstand(PDF, 353 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Mittelstand
Fokus Volkswirtschaft
Die Babyboomer hinterlassen eine große Lücke am Arbeitsmarkt. Zudem hat sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität stark verringert. Deshalb steht eine Phase zunehmenden Arbeitskräftemangels und besonders schwachen Wirtschaftswachstums bevor. Im ersten Teil der Analyse werden folgende Fragen beantwortet: Welche wirtschaftliche Entwicklung wäre für Deutschland bis 2050 zu erwarten, wenn sich die aktuellen Trends bezüglich Erwerbsbeteiligung, Arbeitszeiten und Arbeitsproduktivität fortsetzen? Und wie realistisch ist das? Dazu wurde ein "weiter so"-Szenario berechnet, das auf Basis der Trends das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts fortschreibt. Im zweiten Teil werden die wesentlichen Möglichkeiten beleuchtet, was Deutschland tun kann, um den Fachkräftemangel einzudämmen. Eines ist klar: Die Folgen des demografischen Wandels sind umwälzend, der Handlungsbedarf drängend.
Die ausführliche Studie finden Sie hier(PDF, 3 MB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte
Zu Beginn des 2. Quartals behinderte Fachkräftemangel die Geschäftstätigkeit von 27 % der Unternehmen. Die Fachkräfteknappheit hat sich damit durch die schwache Konjunktur weiter verringert. Am deutlichsten ist der Rückgang in der Industrie, wo die Absatzrückgänge am stärksten sind. Hier melden noch 18 % der Unternehmen Behinderungen durch Fachkräftemangel. Im Dienstleistungsbereich beklagen aktuell 33 % der Unternehmen fehlende Fachkräfte, ebenfalls weniger als im Vorquartal.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Mai 2025(PDF, 223 KB, barrierefrei)
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die demografische Entwicklung in Deutschland stellt mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen: 58 % aller KMU rechnen damit, in den kommenden fünf Jahren Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen zu haben. 33 % sehen wegen des Arbeitskräftemangels mittel- bis langfristig sogar ihre Existenz in Gefahr.
Um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen, setzen KMU vor allem auf Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Arbeitsplatzes. Am häufigsten werden von Mittelständlern mit zukünftigen Stellenbesetzungsproblemen Lohnerhöhungen (67 %), flexiblere Arbeitszeitmodelle bzw. -orte (59 %) und Weiterbildungsangebote (53 %) genannt. Zudem werden nicht selten Konsolidierungsmaßnahmen, die mit Umsatzeinbußen einhergehen können, in Betracht gezogen. Rund 40 % der betroffenen KMU halten es für wahrscheinlich, perspektivisch weniger Aufträge anzunehmen. Die Reduzierung der Produktion, der Öffnungszeiten oder der Erreichbarkeit planen rund 30 %.
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Niemals zuvor seit Start des Nachfolge-Monitorings von KfW Research ziehen so viele mittelständische Unternehmen die Aufgabe ihres Betriebs in Erwägung. Das nahende Rentenalter des Inhabers springt dabei an Nummer 1 der Stilllegungsgründe. Insgesamt denken 231.000 Unternehmen an eine Geschäftsaufgabe bis Ende des Jahres 2025. Dem gegenüber stehen rund 215.000 Unternehmen mit kurzfristigen Nachfolgewünschen im selben Zeitraum. Etwas über der Hälfte dieser Unternehmen können gute Erfolgsaussichten attestiert werden. Die Senior-Generation in den Führungsetagen im Mittelstand verbleibt immer länger im Unternehmen. Das Durchschnittsalter der aktuellen Inhabergeneration erreicht mit über 54 Jahren einen neuen Höchststand. Das verschärft den ohnehin bestehenden Engpass bei Unternehmensnachfolgen nochmals. Um diesem zu begegnen ist eine nachhaltig höhere Gründungsbereitschaft in Deutschland nötig.
Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2024(PDF, 325 KB, barrierefrei)
Weitere Informationen auf der Themenseite Generationenwechsel im deutschen Mittelstand
Der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert sehen, ist durch die anhaltend schwache Konjunktur im 4. Quartal 2024 noch weiter unter die 40 %-Marke gefallen. Nach wie vor wird jedoch in den meisten Wirtschaftszweigen ein erheblicher Teil der Unternehmen durch Fachkräftemangel behindert. Am häufigsten im Dienstleistungsbereich, wo 39 % der Unternehmen sich in ihrer Geschäftstätigkeit durch fehlende Fachkräfte behindert sahen. In der Industrie waren es 21 %. In diversen Dienstleitungszweigen und im Bauhauptgewerbe hat der Fachkräftemangel wieder zugenommen.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Dezember 2024(PDF, 549 KB, barrierefrei)
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die Rahmenbedingungen für Selbstständigkeit werden seit ein paar Jahren von Gründerinnen und Gründern schlechter bewertet als zuvor. Das erhöht den Druck auf die Gründungstätigkeit und schwächt auch die Bestandfestigkeit realisierter Gründungen.
Es ist von hoher Relevanz, die Bedingungen für Existenzgründungen in der Breite zu verbessern. Das ist wichtig für den Wettbewerb, den Erhalt des Mittelstands und die Zukunftsfähigkeit etablierter Unternehmen. Bürokratieabbau nimmt dabei einen besonders hohen Stellenwert ein.
Weitere Informationen zum Thema Existenzgründungen in unserem Dossier
Der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert sehen, ist durch die anhaltend schwache Konjunktur im 2. Quartal 2024 noch weiter unter die 40 %-Marke gefallen. Nach wie vor wird jedoch in den meisten Wirtschaftszweigen ein erheblicher Teil der Unternehmen durch Fachkräftemangel behindert. Am häufigsten im Dienstleistungsbereich, wo 42 % der Unternehmen sich in ihrer Geschäftstätigkeit durch fehlende Fachkräfte behindert sahen. In der Industrie waren es 25 %. Besonders ausgeprägt ist die Fachkräfteknappheit in den östlichen Bundesländern.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Juni 2024(PDF, 437 KB, barrierefrei)
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die Besetzung offener Stellen stellt mittelständische Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen. Insbesondere innovativen Unternehmen fällt die Rekrutierung schwerer. Neben dem allgemeinen Fachkräftemangel liegen die Gründe hierfür in den höheren Anforderungen an die Kompetenzen der Bewerber. Innovative Unternehmen sehen ihre Anforderungen vor allem hinsichtlich der mathematisch-statistischen Fähigkeiten, der Sozial- sowie der Digitalkompetenzen häufiger als nicht erfüllt als andere Unternehmen. Diese höheren Anforderungen sind darauf zurückzuführen, dass innovative Unternehmen neuere Technologien nutzen sowie bei der Arbeits- und Unternehmensorganisation moderner aufgestellt sind. Auch aus den Erfordernissen ihrer Innovationsprozesse resultieren erhöhte Anforderungen bei den genannten Kompetenzen.
Weitere Informationen und Veröffentlichungen auf der Themenseite Innovationen
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die Rückzugsplanungen bei den Inhaberinnen und Inhabern der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland nehmen zuletzt Fahrt auf, wie das neue Nachfolge-Monitoring Mittelstand zeigt: Rund 125.000 mittelständische Unternehmen sollen danach im Zuge einer Nachfolge übergeben werden – und das im Durchschnitt jährlich bis Ende 2027. Dem weiter starken Wunsch einer Nachfolgelösung innerhalb der Familie steht schwindendes Interesse möglicher Nachfolgekandidaten gegenüber. Insgesamt gibt es jährlich nur rund halb so viele Übernahmegründungen wie Nachfolgeplaner im Mittelstand. Der wachsende Engpass erhöht die Anforderungen an die Senior-Generation. Daher ist es sehr erfreulich, dass der Planungsstand der derzeitigen Inhabenden zuletzt so gut war wie nie zuvor. Die Zahl der bereits geregelten Nachfolgen erreicht einen Höchststand. Für fast drei von vier der kurzfristig angestrebten Übergaben bis Ende 2024 haben sich bereits Nachfolger oder Nachfolgerinnen gefunden.
Weitere Informationen auf der Themenseite Generationenwechsel im deutschen Mittelstand
Fokus Volkswirtschaft
Die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit bleibt in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Nur 23 % der 18–67-Jährigen hätten sich 2022 unabhängig von ihrer aktuellen persönlichen Situation für die berufliche Selbstständigkeit entschieden. Ohne aktuelle und ehemalige Selbstständige sind es sogar nur 17 % der Personen im erwerbsfähigen Alter, allerdings können 30 % es sich vorstellen, sich einmal selbstständig zu machen. Die häufigsten Hemmnisse für die Gründungstätigkeit sind Sicherheitsbedürfnisse, Bürokratie und Kapitalmangel.
Weitere Informationen und Veröffentlichungen in unserem Dossier Existenzgründungen
Der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert sehen, ist durch die Konjunkturabschwächung im 4. Quartal 2023 zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder unter die 40%-Marke gefallen. Nach wie vor wird jedoch in den meisten Wirtschaftszweigen ein erheblicher Teil der Unternehmen durch Fachkräftemangel behindert. Am häufigsten im Dienstleistungsbereich, wo 45 % der Unternehmen sich in ihrer Geschäftstätigkeit durch fehlende Fachkräfte behindert sahen. In der Industrie waren es 29 %. Besonders ausgeprägt ist die Fachkräfteknappheit in den östlichen Bundesländern.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Dezember 2023(PDF, 276 KB, barrierefrei)
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Die Studie untersucht, welche Maßnahmen mittelständische Unternehmen ergreifen, um ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Zentrales Ergebnis ist, dass die Unternehmen dabei sehr zielgerichtet und entsprechend ihren Bedürfnissen vorgehen. So favorisieren vor allem große, innovative und bei der Digitalisierung aktive Mittelständler Investitionen in das Knowhow. Auf allgemeine personalpolitische Maßnahmen setzen dagegen häufiger Unternehmen mit älteren Beschäftigten sowie Unternehmen, die keine Hochschulabsolventen beschäftigten.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Fokus Volkswirtschaft
Durch den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ergeben sich neue Anforderungen an die beruflichen Fähigkeiten der Beschäftigten (z.B. hinsichtlich spezifischem wirtschaftlichem, technischem, oder digitalem Know-how). Ergebnisse aus einer Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel zeigen, dass es über der Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen (59 %) an einer oder mehrerer dieser Kompetenzen mangelt. Bei der Beschaffung der fehlenden Qualifikationen setzen Unternehmen vermehrt auf kurze Weiterbildungsmaßnahmen - mit häufig begrenzter Qualifikationswirkung. Um einer Koexistenz von Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken, ist eine Ausweitung der Weiterbildungsaktivitäten notwendig. Hierbei können sich finanzielle Fördermaßnahmen, gezielte Informations- bzw. Beratungsangebote oder eine zunehmende Formalisierung des Weiterbildungsangebotes (z.B. durch Festlegung von Mindeststandards) als hilfreich erweisen.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte
Volkswirtschaft Kompakt
Klimaschutz wird für viele Menschen wichtiger. Das spiegelt sich auch in der Gründungstätigkeit wider. Die Mehrheit der Gründerinnen und Gründer des Jahres 2022 hat den Klimaschutz im Blick. So trägt eine knappe Mehrheit entweder mit ihren angebotenen Produkten und Dienstleistungen zum Klimaschutz bei oder sie setzen auch eigene Klimaschutzmaßnahmen um. Für 12 % der Gründerinnen und Gründer ist Klimaneutralität das angestrebte Ziel ihrer Klimaschutzmaßnahmen.
12 von 100 Gründerinnen und Gründer wollen Klimaneutralität erreichen(PDF, 293 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen
Volkswirtschaft Kompakt
Die Gründungstätigkeit von Migrantinnen und Migranten hat im Jahr 2022, das im Zeichen von Ukraine-Konflikt, Energiekrise, Inflation und konjunktureller Unsicherheit stand, erneut nachgelassen. Die Gründungsquote fiel auf 98 Gründungen je 10.000 Erwerbspersonen. Sie rutschte damit unter die Quote in der Gesamtbevölkerung von 108 Gründungen. Mit 22 % ging damit zuletzt etwas mehr als jede fünfte aller Gründungen in Deutschland auf Migrantinnen und Migranten zurück.
Auch migrantische Gründungstätigkeit in der Polykrise verhaltener(PDF, 355 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen
Volkswirtschaft Kompakt
Unternehmen, die Klimaschutz (teilweise) in ihrer Unternehmensstrategie verankert haben, rechnen mit einem Anteil von 66 % häufiger mit Problemen bei der Stellenbesetzung als Unternehmen, die Klimaschutz nicht in ihrer Strategie berücksichtigen (59 %). Das zeigen aktuelle Ergebnisse aus dem KfW-Mittelstandspanel. Die Unterschiede in den Stellenbesetzungsproblemen sind häufig auf fehlende digitale Fähigkeiten und Qualifikationen der Bewerbenden zurückzuführen. Damit mangelnde (Digital-)Kompetenzen nicht zum zentralen Hindernis der Dekarbonisierung werden, sollten Aus- und Weiterbildungsangebote auf die Qualifikationsanforderungen grüner Unternehmen zugeschnitten werden. Insgesamt gilt es zudem relevante Schnittstellenkompetenzen zu identifizieren und vermehrt in das Bildungsangebot zu integrieren, da Klimaschutz im unternehmerischen Handeln an vielen Stellen Berührungspunkte zu weiteren Themengebieten aufweist.
Weitere Veröffentlichungen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Fokus Volkswirtschaft
Die demografische Alterung setzt Unternehmen bei Nachfolgen gleich doppelt unter Druck: Auf der einen Seite steigt die Zahl an nachfolgebereiten Inhaberinnen und Inhaber, während parallel auf der anderen Seite die Zahl an potenziellen Übernehmerinnen und Übernehmern sinkt. Eine höhere Sichtbarkeit von Positivbeispielen sowie eine bessere Informationsbereitstellung zu Finanzierungsmöglichkeiten sind Ansatzpunkte zum Gegensteuern.
Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen
Im April 2023 meldeten 42,2 % der Unternehmen im KfW-ifo-Fachkräftebarometer eine Behinderung ihrer Geschäftstätigkeit durch fehlende Fachkräfte. Im Dienstleistungsbereich waren es 47,4 %, im Verarbeitenden Gewerbe mit 35,1 % erheblich weniger. Der Fachkräftemangel hat sich damit durch die konjunkturelle Abschwächung deutlich veringert. Im Juli letzten Jahres behinderte Fachkräfteknappheit noch die Geschäftstätigkeit von 49,7 % der Unternehmen. Aus heutiger Sicht ist damit zu rechnen, dass sich die Konjunktur im weiteren Verlauf des Jahres vom Preisschock allmählich erholt. Die Fachkräfteknappheit wird daher voraussichtlich konjunkturell wie auch demografisch bedingt wieder zunehmen.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Juni 2023(PDF, 266 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte in Deutschland
Fokus Volkswirtschaft
Das neue Nachfolge-Monitoring Mittelstand zeigt, dass jedes Jahr rund 100.000 Inhaberinnen und Inhaber mittelständischer Unternehmen eine Nachfolge anstreben. Die Relevanz des Themas Unternehmensnachfolge hat damit nichts an Aktualität eingebüßt. Rund zwei Drittel der kurzfristigen Nachfolgepläne bis Ende 2023 sind bereits in trockenen Tüchern. Jeder vierte kurzfristige Nachfolgewunsch wird sich allerdings auch mangels ausreichender Planung nicht erfüllen. Der Wunsch, die Nachfolge innerhalb der Familie zu regeln, bleibt weiter ausgeprägt. Generell ist der Mangel an passenden Kandidaten die größte Hürde einer erfolgreichen Nachfolgeregelung, die Knappheit ist aufgrund zu geringer Gründungszahlen hoch. Zusätzlich steigt der Bedarf, die Zahl der älteren Inhaberinnen nimmt zu. Aktuell sind bereits 1,2 Mio. Unternehmerinnen 60 Jahre oder älter, annähernd eine Verdreifachung in den letzten zwanzig Jahren. Die Nachfolgelücke wächst, ungewollte Stilllegungen im Mittelstand dürften zunehmen.
Weitere Analysen in unserem Dossier Mittelstand
Fokus Volkswirtschaft
Stellenbesetzungsprobleme treffen digital aktive Unternehmen in einem besonders starken Ausmaß. Der Mangel an Bewerberinnen und Bewerber ist hier der wichtigste Grund für die Stellenbesetzungsprobleme. Gerade Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten haben besondere Anforderungen an die Kompetenzen ihrer Bewerber. Für die Unternehmen bedeutet dies, dass sie in erster Linie selbst verstärkt in die Kompetenzen ihrer Beschäftigten investieren müssen. Auch Rationalisierungsmaßnahmen zur Begrenzung des Fachkräftebedarfs sowie eine bessere Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials können in einem gewissen Ausmaß zur Linderung des Problems beitragen.
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Dossier Digitalisierung
Volkswirtschaft Kompakt
Noch nie gab es so viele Unternehmen im Mittelstand mit einer Frau an der Spitze: Die Anzahl von Frauen in der Leitung eines mittelständischen Unternehmens lag im Jahr 2022 bei rund 757.000. Damit wurde jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen von einer Frau geführt, wie eine jüngste Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt. Frauen sind im Mittelstand dabei besonders in Dienstleistungsbereichen aktiv: Mehr als neun von zehn Chefinnen lenken ein mittelständisches Dienstleistungsunternehmen. Einen wesentlichen Anteil an der gestiegenen Frauenquote hat die wieder schwungvollere Gründungstätigkeit von Frauen am aktuellen Rand. Eine anziehende Gründungsneigung von Frauen ist der notwendige zentrale Impuls für langfristig mehr Chefinnen im Mittelstand.
Fokus Volkswirtschaft
Die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit bleibt auch im zweiten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie niedrig. Nur 23 % der Erwerbsfähigen in Deutschland würden sich 2021 unabhängig von ihrer aktuellen persönlichen Situation für die berufliche Selbstständigkeit entscheiden. Die unter 30-Jährigen haben den Corona-Schock aber besser verdaut und würden sich wieder häufiger für die Selbstständigkeit entscheiden.
Von den Erwerbsfähigen, die noch nie selbstständig waren, können sich 32 % vorstellen, einmal selbstständig zu werden. Das ist mehr als ein Viertel aller Erwerbsfähigen (26 %) und zeigt, dass Gründungspotenziale durchaus vorhanden sind. Um diese zu heben, scheinen weniger Bürokratie, eine faire Einbindung in die Sozialversicherungssysteme und eine bessere Absicherung im Insolvenzfall vielversprechende Maßnahmen zu sein.
Weitere Analysen zum Thema Existenzgründungen
Fokus Volkswirtschaft
Über 70 Jahre lang konnte wirtschaftliches Wachstum in Deutschland als sicher gelten. Diese Zeiten sind vorbei. Das liegt maßgeblich auch am schwachen Produktivitätswachstum. Wollte Deutschland allein durch steigende Erwerbsbeteiligung oder Zuwanderung das BIP je Einwohner bis zum Jahr 2035 konstant halten, müsste dafür entweder die Erwerbsbeteiligung weit stärker als bisher steigen oder die Netto-Zuwanderung auf weit mehr als 1,3 Mio. Menschen im Erwerbsalter zunehmen. Wohlstandssicherung und weiteres Wohlstandswachstum bedürfen deshalb eines umfassenden Mix an Maßnahmen, die auch eine stärkere Erhöhung der Arbeitsproduktivität bewirken. Dieser Beitrag zeigt anhand von Szenarien die Notwendigkeiten auf und beleuchtet mögliche Gegenmaßnahmen.
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Nach dem neuen KfW-ifo-Fachkräftebarometer behinderte Fachkräftemangel zu Beginn des 4. Quartals die Geschäftstätigkeit von 46 % der Unternehmen. Die Fachkräfteknappheit hat sich gegenüber dem Vorjahr trotz Ukraine-Krise weiter verstärkt. Fachkräfte fehlen in allen Wirtschaftsbereichen, am häufigsten im Dienstleistungsbereich, wo fast die Hälfte der Unternehmen durch fehlende Fachkräfte behindert wird. Offene Stellen sind mittlerweile im Durchschnitt 5 Monate vakant. Die Besetzungsdauer steigt steil an. Eine Ursache dafür ist das schwache Wachstum der Erwerbstätigenproduktivität. Die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigen stagnierte in den letzten 5 Jahren fast.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Dezember 2022(PDF, 354 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Volkswirtschaft Kompakt
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, investieren die deutschen Kommunen seit mehreren Jahren verstärkt in ihre Kindertageseinrichtungen. Laut bundesweiter Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel 2022 liegen die geplanten Investitionen für Kitas bei 3,2 Mrd. EUR, etwas weniger als in den Vorjahren. Dieses Investitionsniveau ist nicht ausreichend, um die steigenden Bedarfe zu erfüllen. Daher steigt der wahrgenommene Investitionsrückstand auf nun 10,5 Mrd. EUR. Die Kommunen sind allerdings tendenziell optimistisch, die Investitionslücke zukünftig etwas schließen zu können, sofern die Finanzlage nicht durch die verschiedenen Krisen wieder in Mitleidenschaft gezogen wird.
Mobilisierung von Gründerinnen ist wirtschaftliche Chance und gesellschaftliche Aufgabe
Frauen sind bei Existenzgründungen in Deutschland mit einem Anteil von durchschnittlich 39 % strukturell unterrepräsentiert. Neben expliziten Hemmnissen, wie etwa Fehlanreize im Transfersystem, bremsen vor allem kulturelle Rahmenbedingungen als weiche Faktoren die Gründungstätigkeit von Frauen.
Um Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen entlang des gesamten Gründungsprozesses – von Gründungswunsch bis Realisierung – herzustellen, bedarf es eines breit angelegten und tiefgreifenden Wandels. Vier Zielbereiche erscheinen dabei vorrangig:
1) Den Gründungswunsch von Frauen zu erhöhen,
2) mehr Gründerinnen von „Unternehmen“ zu bewirken,
3) mehr Gründerinnen mit Wachstums-, Technologie- und Innovationsorientierung zu bewirken und
4) den Zugang von Gründerinnen zu Venture Capital zu verbessern.
Female Entrepreneurship(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Grafiken und Informationen auf unserer Themenseite Female Entrepreneurship
Nach Corona-Knick hat sich Zahl der Start-ups 2021 wieder erholt
Der Bestand an innovations- oder wachstumsorientierten jungen Unternehmen in Deutschland hat sich wieder erholt. Nach dem coronabedingten Knick im Jahr 2020 stieg die Zahl der Start-ups 2021 auf 61.000 an. Gründerinnen und Gründer, die Venture Capital nutzen wollen, haben eher Merkmale, die den VC-Zugang erleichtern: Sie vereinen häufiger Innovations- und Wachstumsorientierung, haben häufiger einen akademischen Hintergrund, haben deutlich häufiger digitale Angebote, internetbasierte Geschäftsmodelle und internationale Zielmärkte. Dabei streben Start-up-Gründerinnen aber seltener eine VC-Finanzierung an.
Fokus Volkswirtschaft
Humankapital ist die zentrale Ressource der deutschen Volkswirtschaft, und entsprechend wichtig ist berufliche Weiterbildung. Im Jahr 2021 haben sich jedoch – trotz leichter Steigerung – immer noch nur 40 % der Erwerbsbevölkerung weitergebildet. Ein Grund ist die Corona-Krise: Etwa ein Drittel der Erwerbsbevölkerung hat im vergangenen Jahr nach eigener Einschätzung wegen der Pandemie an weniger (oder gar keiner) Weiterbildung teilgenommen. Gleichzeitig hat Corona hat die Weiterbildungslandschaft unvermittelt ins digitale Zeitalter katapultiert: Im Jahr 2021 fand die Hälfte der Veranstaltungen rein online statt, drei Jahre zuvor waren es nur 4 %. Nun gilt es, kontinuierlich an der Qualität digitaler Lernformate zu arbeiten, um ihr großes Potenzial für flexibles, effizientes Lernen auszuschöpfen – und so die Weiterbildungsquote insgesamt zu steigern.
Fokus Volkswirtschaft
Bildung ist eine zentrale Säule des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Moderne Schulgebäude sind eine wesentliche Voraussetzung für ein leistungsfähiges Bildungssystems. Die seit Jahren hohen Investitionsrückstände im Schulbereich geben deshalb Anlass zur Sorge. Gegenwärtig ist dabei weniger das absolute Niveau der Rückstände problematisch, das in nominalen Größen in den vergangenen Jahren sogar gesunken ist. Vielmehr sind die sich scheinbar verstärkenden regionalen Unterschiede bei der Schulinfrastruktur im Blick zu behalten. Deshalb gilt es die Investitionsfähigkeit der Kommunen in allen Regionen sicher zu stellen, damit zentrale Infrastrukturbereiche wie Schulgebäude überall in einem angemessenen Umfang und Zustand bereitgestellt werden können.
Fokus Volkswirtschaft
Nicht alle Unternehmenslenkerinnen und -lenker streben nach dem eigenen Rückzug die Fortführung des Unternehmens an. Rund 266.000 mittelständische Unternehmen werden nach aktueller Einschätzung von ihren Inhaberinnen und Inhabern bis zum Ende des Jahres 2025 stillgelegt – ohne den Weg einer Nachfolge beschreiten zu wollen. Dabei sind Nachfolgermangel – vor allem fehlendes Interesse von Familienangehörigen an einer Übernahme – , das nahende Erreichen des Rentenalters und eine oftmals geringe wirtschaftliche Attraktivität ausschlaggebende Faktoren. Weitere rund 199.000 Unternehmerinnen und Unternehmer stehen einer unfreiwilligen Geschäftsaufgabe gegenüber. Sie wünschen sich eine Nachfolgelösung bis Ende des Jahres 2025, müssen aber aufgrund bislang unzureichender Planung mit einem Scheitern rechnen.
Fokus Volkswirtschaft
Der Generationenwechsel im Mittelstand schreitet voran. Bis zum Ende des Jahres 2025 streben 16 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine Nachfolgelösung an. Doch die Hürden sind hoch, wie eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt: Drei Viertel aller KMU betrachten es als Problem, eine geeignete Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger zu finden. Die Einigung auf einen Kaufpreis sehen knapp 40 % KMU als wesentliche Hürde. Unter den ca. 600.000 KMU, die die Nachfolge bis Ende 2025 anstreben, droht etwa 165.000 die unfreiwillige Stilllegung oder zumindest eine erhebliche Verzögerung. Entscheidend für das Gelingen der Unternehmensnachfolge im Mittelstand ist die Aktivierung und Unterstützung potenzieller Übernahmegründerinnen und -gründer.
Gründungstätigkeit 2021 zurück auf Vorkrisenniveau: mehr Chancengründungen, mehr Jüngere, mehr Gründerinnen
Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist nach dem Corona-Knick 2020 im Jahr 2021 wieder auf das Vorkrisenniveau gestiegen. Mit 607.000 Existenzgründungen haben sich 70.000 bzw. 13 % mehr Menschen selbstständig gemacht als 2020. Dabei ist die Zahl der Chancengründungen gestiegen. Auch haben sich mehr Jüngere und mehr Frauen selbstständig gemacht. Durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie waren 2021 auch deutlich mehr Gründungen digital und internetbasiert. Trotz sinkender Planungsquote ist zu erwarten, dass sich die Gründungstätigkeit 2022 auf einem ähnlichen Niveau bewegen wird wie 2021.
KfW-Gründungsmonitor 2022(PDF, 526 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
In den kommenden zehn Jahren werden Fachkräfteengpässe spürbar zunehmen. Wie eine repräsentative Befragung von KfW Research zeigt, sieht die Bevölkerung den Bedarf einer aktiven Einwanderungspolitik sehr deutlich: 83 % der 18- bis 67-Jährigen sind für mindestens gleichbleibende Bemühungen um ausländische Fachkräfte, darunter 48 % für größeres Engagement. Im Vergleich zu einer identischen Befragung vor drei Jahren ist die migrationspolitische Haltung insgesamt offener geworden, unterscheidet sich aber nach wie vor deutlich nach der beruflichen Bildung, dem Einkommen und dem Arbeitsmarktstatus. Bei niedrigeren Berufsabschlüssen und Einkommen bzw. Arbeitslosigkeit verschiebt sich das Stimmungsbild deutlich (ohne jedoch zu kippen).
Weitere Informationen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Im April 2022 sahen sich 44 % aller Unternehmen durch Fachkräftemangel beeinträchtigt. Damit sind fehlende Fachkräfte wieder zu einem weitaus häufigeren Produktionshemmnis geworden als vor der Pandemie. Alle Wirtschaftsbereiche sind davon betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe sahen rund 40 % der Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert, der mit Abstand höchste Anteil der letzten 30 Jahre.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Mai 2022(PDF, 221 KB, barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Fachkräfte für Deutschland
Fokus Volkswirtschaft
Höherqualifizierung und der Aufstieg in Führungspositionen sind besser denn je geeignet, hohe Einkommen zu erzielen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Bruttomonatsverdienste von Vollzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Zwischen 2010 und 2020 sind die Bruttomonatsverdienste von Akademikern und Führungskräften deutlich stärker gestiegen als diejenigen von Fachkräften mit betrieblicher Ausbildung und von Hilfskräften. Höherqualifizierung und Aufstieg in Führungspositionen sind besser denn je geeignet, hohe Einkommen zu erzielen. Auch nach Umverteilung zahlt sich höhere Bildung aus. Die Berufswahl hat ebenfalls großen Einfluss auf das Einkommen.
Volkswirtschaft Kompakt
Immer mehr Menschen fliehen aus der Ukraine und auch in Deutschland werden viele Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz und Zukunftsaussichten suchen. Nach ihrer Grundversorgung hat die Bildung der minderjährigen Flüchtlinge hohe Priorität. Die Voraussetzungen für die Integration ukrainischer Kinder sind relativ gut, denn das ukrainische Schulsystem ist leistungsfähiger als in den meisten anderen Flucht-Herkunftsländern. Die PISA-Ergebnisse der Ukraine liegen zwar etwas unter dem OECD-Durchschnitt, aber höher als in einzelnen EU-Staaten. Neben der schnellen Bereitstellung von Ressourcen für Sprachförderung geht es nun um die Aktivierung zivilgesellschaftlicher Kräfte, insbesondere in der ukrainisch- und russischstämmigen Bevölkerung.
Geflüchtete aus der Ukraine: frühzeitig Bildungschancen schaffen(PDF, 125 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
In den letzten 10 Jahren sind die Bruttoverdienste von vollzeitbeschäftigten Frauen im Dienstleistungsbereich und Produzierenden Gewerbe wesentlich stärker gestiegen als die von Männern, und das in allen Qualifikations- und Führungsstufen. Zudem hat der Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich zugenommen. Aber das Aufholen braucht Zeit. Aktuell beträgt der Gender-Pay-Gap noch 19 %. Setzt sich das Aufholen wie im letzten Jahrzehnt fort, wird es jedoch noch etwa 30 Jahre dauern, bis der Gender-Pay-Gap abgebaut ist.
Einkommen und Karriere: Frauen holen auf, aber der Weg ist noch weit(PDF, 145 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Nachdem das Lockdown-Jahr 2020 die Zukunftsplanungen vieler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) auf Eis gelegt hatte, rückt das Nachfolgemanagement nun wieder höher auf der Agenda. Bis zum Ende des Jahres 2022 streben rund 230.000 der 3,8 Mio. KMU eine Nachfolge an, bis Ende 2025 sind es ca. 600.000. Auch wenn zumindest bei den kurzfristig anstehenden Nachfolgevorhaben oft bereits ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden wurde, besteht in Deutschland eine strukutrelle Nachfolgelücke. Einer alterndern Unternehmerschaft stehen zu wenige jüngerer Personen mit zu geringer Gründungsneigung gegenüber. Die Nachfolge innerhalb der Familie ist in der Krise zwar beliebter denn je, doch mittelfristig wird der Anteil externer Übergaben allein schon aus demografischen Gründen wieder zunehmen müssen.
Fokus Volkswirtschaft
Wie das KfW-Mittelstandspanel zeigt, hat im Jahr 2020 nur etwas mehr als ein Drittel (36 %) der kleinen und mittleren Unternehmen Weiterbildung selbst durchgeführt oder gefördert, im Durchschnitt für die Hälfte ihrer Belegschaft. Die aggregierten Weiterbildungsausgaben des Mittelstands belaufen sich auf ungefähr 10 Mrd. EUR bzw. ca. 5 % der gesamten mittelständischen Investitionen in Anlagen und Bauten. Diese ernüchternden Zahlen sind eine Bestandsaufnahme inmitten der Corona-Krise, doch selbst eine zügige Rückkehr zum Vorkrisenniveau würde den aktuellen Herausforderungen des Strukturwandels nicht gerecht. Problem ist, dass der Weiterbildungssektor im Status quo zu unübersichtlich und informell ist, er weist Angebotslücken und zu geringe Teilnahmequoten auf. KfW Research sieht die wesentlichen Stellschrauben für systematische und hochwertige Weiterbildung in der Breite auf drei Gebieten: 1. Verbesserung des Angebots, 2. finanzielle Förderung, 3. Schaffung von Zeitressourcen.
Fokus Volkswirtschaft
Die Unternehmensinvestitionen in Deutschland sind (zu) niedrig. Die Corona-Krise hat dabei einen bereits längerfristigen Trend nochmals verschärft, speziell im Mittelstand. Doch steht gerade jetzt die Transformation in Richtung Klimaneutralität und Digitalisierung auf der Agenda. Das erfordert enorme Investitionen. Zuversicht ist dabei die zentrale Stellschraube, damit Unternehmen Investitionen angehen. Investitionsbereitschaft, -höhe und Zielrichtung sind entscheidend von der Geschäftserwartung der Unternehmer und Unternehmerinnen abhängig. Auch demografische Prozesse spielen eine große Rolle. Die Neigung zu investieren sinkt mit dem Alter. Vor allem bei kleinen Unternehmen sind Investitionsentscheidungen an die Person des Inhabenden gekoppelt. Klassische Faktoren spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Die Wirtschaftspolitik kann helfen: Grundlegende Voraussetzung für rege Unternehmensinvestitionen sind sichere wirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen.
Warum Unternehmen (nicht) investieren(PDF, 143 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die deutsche Wirtschaft steht vor historischen Herausforderungen: Es gilt unter anderem Klimaneutralität zu erreichen, den wachsenden Fachkräftemangel einzudämmen, die Renten demografiefest zu machen, in der Digitalisierung wettbewerbsfähig zu werden und die stark gestiegenen Staatsschulden zu senken. Ein höheres Wachstum der Arbeitsproduktivität könnte die Bewältigung wesentlich erleichtern. Denn gelingt es nicht, das Produktivitätswachstum zu stärken, wird sich das Wirtschaftswachstum schon in wenigen Jahren gravierend abschwächen. Eine Studie von KfW Research zeigt die Dimension der Herausforderungen und die Ursachen für das schwache Produktivitätswachstum auf und legt dar, wo die Wirtschaftspolitik ansetzen kann, um das Produktivitätswachstum zu erhöhen. Zur Umsetzung wird ein umfassendes wirtschaftliches Reformprogramm vorgeschlagen.
Die zu Grunde liegende Studie: Wie lässt sich das Produktivitätswachstum stärken?(PDF, 3 MB, nicht barrierefrei)
Präsentation Herausforderung Produktivitätswachstum(PDF, 401 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Im Jahr 2020 ist die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit in der Erwerbsbevölkerung gesunken. Nur 25 % würden sich unabhängig von ihrer aktuellen Situation für die Selbstständigkeit als Erwerbstätigkeit entscheiden. In den Vorkrisenjahren ist der Gründungsgeist bei jungen Erwachsenen wiedererstarkt. Einen Schub gab es insbesondere von Studierenden. Dieser Gründungsgeist hat sich jetzt aber wieder verflüchtigt. Bei Frauen ist die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit relativ stärker gesunken als bei Männern. Den Gründungsgeist neu zu entfachen ist eine wichtige, wenn auch herausfordernde Aufgabe.
Im Oktober 2021 sahen sich 43 % aller Unternehmen durch Fachkräftemangel beeinträchtigt. Im Oktober 2020 waren es – coronabedingt – lediglich 23,7 % gewesen. Damit sind fehlende Fachkräfte seit dem Sommer zu einem weitaus häufigeren Produktionshemmnis geworden als vor der Pandemie. Alle Wirtschaftsbereiche sind davon betroffen. Im Verarbeitenden Gewerbe sahen rund 37 % der Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert, der mit Abstand höchste Anteil der letzten 30 Jahre.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer November 2021(PDF, 176 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zu Fachkräfte in Deutschland
Volkswirtschaft Kompakt
Die Corona-Krise beeinträchtigt die Gründungstätigkeit von Migranten und Migrantinnen in Deutschland offenbar besonders stark. Mit 110.000 Gründungen betrug ihr Anteil an der ohnehin rückläufigen Zahl der Existenzgründungen 2020 rund 21 %. Im Vorjahr hatte er noch bei 26 % gelegen. Der Gründungsanteil lag 2020 damit erstmalig seit 2009 wieder unter dem Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Erwerbsbevölkerung. Trotz des Rückgangs ist ein coronabedingter Druck zur Selbstständigkeit sichtbar. So blieben Notgründungen häufig und der Fokus auf eine regionale Geschäftstätigkeit verstärkte sich. Die überdurchschnittlich häufige Wachstumsorientierung blieb aber vorhanden.
Die Digitalisierung gehört im Mittelstand zum Geschäftsalltag. Für über 80 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind grundlegende Digitalkompetenzen wie z. B. die Bedienung von Computern, Tablets und Standardsoftware von großer Bedeutung. Ein Viertel der KMU hat zudem Bedarf an fortgeschrittenen Fähigkeiten wie Programmieren oder Datenanalyse. Eine Sonderbefragung im KfW-Mittelstandspanel zeigt, dass es einem von drei Unternehmen an dringend benötigten Digitalkompetenzen mangelt. Eine Weiterbildungsoffensive könnte verhindern, dass fehlende Digitalkompetenzen zum wesentlichen Hemmnis des digitalen Strukturwandels werden.
Die Digitalisierung in Schulen war für die kommunalen Schulträger schon vor Corona ein wichtiges Thema. Die Corona-Krise hat nun Defizite und Potenziale der Digitalisierung deutlich gemacht und zwingt alle Beteiligten, mehr Tempo an den Tag zu legen. Der größte Handlungsbedarf besteht aktuell bei Lernplattformen und Cloudlösungen, um den digitalen Unterricht zu erleichtern. Als bedeutendes Hindernis stellt sich der Mangel an ausreichend qualifiziertem Personal für die Kommunen als Schulträger dar. Um die Digitalisierung in den Schulen dauerhaft und nachhaltig voranzubringen, fehlt den Kommunen die finanzielle Planungssicherheit, denn die gerade zu Anfang anfallenden Kosten sind beachtlich. Die Investitionsbedarfe werden allerdings dauerhaft bedeutsam sein, wie die Ergebnisse einer Umfrage unter den Kommunen zeigen.
Präsentation zur Ad hoc Umfrage "Digitalisierung in Schulen"(PDF, 421 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Kommunale Investitionen in die Bildung
Die Ausbildungsaktivität, die weit überwiegend in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) stattfindet, wurde durch die Corona-Krise stark beeinträchtigt. Bei 28 % der Ausbildungsunternehmen ist im Jahr 2020 die Anzahl der Azubis gesunken. Insgesamt gab es in Deutschland einen Rückgang um 3 % von 1,33 auf 1,29 Mio. Azubis. Eine aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels ergibt auch für das gerade gestartete Ausbildungsjahr eine negative Tendenz: 26 % der Ausbildungsunternehmen rechnen auch im Jahr 2021 mit einem Rückgang. Trotz der in Fahrt kommenden Konjunktur ist eine schnelle Erholung des Ausbildungsmarkts unwahrscheinlich.
Neues Ausbildungsjahr 2021: schnelle Erholung unwahrscheinlich(PDF, 123 KB, nicht barrierefrei)
Die Inflationsraten und Zinsen in den Industrieländern (IL) gehen seit gut 30 Jahren trendmäßig zurück. Heute liegen sie deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt. Dabei sind die Notenbanken mit ihrer Niedrig- und Negativzinspolitik zwar ein wichtiger, aber keinesfalls alleiniger Treiber dieser Entwicklung. So dürften es vor allem demografische Prozesse, der Aufstieg Chinas und die fortschreitende Globalisierung seit den 1990er-Jahren gewesen sein, die Abwärtsdruck auf Preise und das Zinsniveau ausgeübt haben. Das heißt: Selbst ohne die geldpolitischen Krisenmaßnahmen des letzten Jahrzehnts dürften Zinsen und Inflation heute niedriger als beispielsweise noch in den 1990er-Jahren sein. Unsere Studie diskutiert die Wirkungsketten dieser Prozesse näher und erläutert, dass längerfristige Aufwärtsrisiken für die Inflationsrate und die Zinsen in den IL vor allem aus einer Umkehr derselben resultieren dürften.
Im 2. Quartal nimmt der Fachkräftemangel weiter deutlich zu. Das zeigen die Erhebungen zum aktuellen KfW-ifo-Fachkräftebarometer. Ein Viertel aller Unternehmen sieht seine Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert, mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr. Der Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren ohne weiteres Gegensteuern zu einem gravierenden Wachstumshemmnis werden. Deutschland braucht daher eine Strategie zur Fachkräftesicherung für die Nach-Coronazeit. Um die Knappheit erfolgreich einzudämmen sind eine höhere Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung, eine verbesserte Qualifikation von Erwerbstätigen und eine Stärkung des Wachstums der Arbeitsproduktivität durch günstigere Rahmenbedingungen für Investitionen, Innovationen und Digitalisierung sowie der Abbau der Defizite in der digitalen und wirtschaftsnahen Infrastruktur erforderlich.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Juni 2021(PDF, 169 KB, nicht barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
Die Corona-Krise hat der Ausbildungsaktivität der KMU – und damit insgesamt - einen kräftigen Dämpfer verpasst: Im Jahr 2020 hat jedes vierte (26 %) ausbildende KMU aufgrund der Krise weniger neue Auszubildende eingestellt als ursprünglich geplant. Insgesamt wurden fast 50.000 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen als im Vorjahr (-9 %). Für die Zukunft der durch die Krise ausgebremsten Schulabsolventen sowie für die Wettbewerbsfähigkeit der KMU ist es wichtig, die nicht zustande gekommenen Ausbildungsverhältnisse möglichst schnell nachzuholen. Doch kurzfristig ist selbst die Rückkehr zum Vorkrisenniveau unwahrscheinlich.
Zur Themenseite Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen
Fokus Volkswirtschaft
Die betriebliche Weiterbildung wurde im Jahr 2020 durch die Corona-Krise hart ausgebremst, weil es vielen Unternehmen an Geld, Zeit und Planungssicherheit mangelt. Eine aktuelle Sondererhebung im KfW-Mittelstandspanel zeigt, dass fast 40 % der kleinen und mittleren Unternehmen im vergangenen Jahr ihre Weiterbildungsaktivitäten reduziert haben, die Hälfte davon auf null. Der Weiterbildungsbedarf besteht jedoch in der Krise fort. Auf dem Gebiet der Digitalkompetenzen ist er im Jahr 2020 sogar kräftig gestiegen. Fehlende Digitalkompetenzen der Beschäftigten sind eine der größten Hürden des digitalen Strukturwandels – was den krisenbedingten Einbruch der Weiterbildung umso problematischer für die künftige Transformations- und Wettbewerbsfähigkeit macht.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Fachkräftemangel in der Corona-Krise – das neue KfW-ifo-Fachkräftebarometer
Das neu konzipierte KfW-ifo-Fachkräftebarometer zeigt auf, in welchem Umfang Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert sehen – insgesamt und nach Wirtschaftszweigen und Regionen differenziert. Im 1. Quartal 2021 wurde die Geschäftstätigkeit von 20,6 % der Unternehmen in Deutschland von Fachkräftemangel behindert. Trotz des Lockdowns waren das 5,6 Prozentpunkte mehr als noch im 3. Quartal 2020. In wichtigen Dienstleistungsbereichen wie Architektur- und Ingenieurbüros, Rechts- und Steuerberatung und Dienstleistungen der Informationstechnik sind zwischen 30 und 50 % der Unternehmen betroffen. In den folgenden Jahren kann Fachkräfteknappheit durch den sukzessiven Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge und das schwache Wachstum der Arbeitsproduktivität zu einem gravierenden Wachstumshemmnis werden. Das KfW-ifo-Fachkräftebarometer erscheint künftig im Frühjahr und Herbst, um die Entwicklung zu analysieren.
KfW-ifo-Fachkräftebarometer Januar 2021(PDF, 162 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die berufliche Selbstständigkeit wird heutzutage häufig als Wagnis gesehen. Tatsächlich sind Selbstständige – insbesondere „frische“ Gründerinnen und Gründer – im Durchschnitt risikobereiter als der Rest der Erwerbsbevölkerung. Dabei sind Gründer deutlich risikobereiter als Gründerinnen. Das ist auf den höheren Nebenerwerbsanteil bei Gründerinnen zurückzuführen. Die zunehmende Unsicherheit des gesamtwirtschaftlichen Umfelds in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass weniger risikobereite Menschen das Interesse an einer Selbstständigkeit verloren haben. Der sinkende Gründungsgeist ist volkswirtschaftlich aber ein Problem. Es wäre klug, etwas zu unternehmen, um den Gründungsgeist wiederzubeleben. Unsicherheit bzw. Risiko kann jetzt schon für viele Selbstständige reduziert werden.
Volkswirtschaft Kompakt
Die meisten Deutschen sind Weiterbildungsmuffel. Das gilt gerade für Geringqualifizierte und Beschäftigte im Niedriglohnbereich. Der Trend steigt zwar, aber im Jahr 2018 nahmen 60 % der Erwerbspersonen nicht an betrieblicher Weiterbildung teil. Unter den Erwerbspersonen mit niedrigem Bildungsabschluss waren es sogar 75 %. Dies ist bedenklich, weil die Corona-Krise viele Arbeitsplätze gefährdet und der digitale, demografische und ökologische Strukturwandel die Anpassungsfähigkeit der Erwerbspersonen weit stärker fordert. Auch kann Weiterbildung den zunehmenden Fachkräfteengpässen entgegenwirken. Für eine Kultur lebenslangen Lernens gilt es daher, die Defizite bei Bildung und Weiterbildung zu beheben.
Alle Studien zum Thema Fachkräfte
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Fokus Volkswirtschaft
Die Unternehmen sind im Corona-Jahr 2020 plötzlich mit existenziellen Problemen beschäftigt und legen ihre Zukunftsplanung auf Eis – auch hinsichtlich der Übergabe an die nächste Generation. Daran liefert das Nachfolge-Monitoring von KfW Research eine positive Momentaufnahme. Erstens halten zumindest viele Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Rückzug kurz bevorsteht, auch in der Krise an ihren Übergabeplänen fest. Zweitens sind sie gut vorbereitet in die Krise gegangen und halten bereits laufende Nachfolgeprozesse auf Kurs: Knapp die Hälfte der ca. 260.000 für die kommenden zwei Jahre vorgesehenen Übergaben ist fertig verhandelt. Doch mit zunehmender Krisendauer steigt das Risiko gescheiterter Nachfolgen. Ein Grundproblem wird durch die Krise noch verschärft: Es mangelt wegen ungünstiger Demografie und schwachem Gründergeist an Nachwuchs. Der Abbau von Gründungshürden ist zentral für den Generationenwechsel im Mittelstand.
Fokus Volkswirtschaft
Die zunehmende wirtschaftspolitische Unsicherheit der vergangenen Jahre verdirbt die Gründungslust. Umso erfreulicher ist es, dass unter Jüngeren die Präferenz für eine berufliche Selbstständigkeit wieder zugenommen hat, besonders unter Studierenden. Die Corona-Krise trieb die Unsicherheit aber auf neue Höhen. Der Gründungsgeist wird dadurch wohl wieder einen Dämpfer erhalten. Die wirksame Unterstützung der durch die Krise betroffenen Selbstständigen und Unternehmen kann aber helfen, dass es hoffentlich nur ein vorübergehender Dämpfer sein wird.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Volkswirtschaft Kompakt
Wohl nur langsam wird sich nach diesen Sommerferien der Unterricht an deutschen Schulen normalisieren. Dabei hat die Corona-Krise den Wert einer funktionierenden schulischen Infrastruktur deutlich gemacht. Für den Zustand der Schulgebäude sind zumeist die Städte, Gemeinden oder Landkreise als Schulträger zuständig. Die zuletzt gestiegenen Investitionen konnten die wachsenden Bedarfe aber nicht ausgleichen, sodass der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen für den Bereich Schulen im KfW-Kommunalpanel 2020 wieder zugenommen hat. Durch die Folgen der Corona-Krise könnten die kommunalen Investitionen nun unter Druck geraten. Die Stabilisierung der Kommunalfinanzen ist darum ein entscheidender Punkt, um die weitere Stärkung der Bildungslandschaft in Deutschland zu gewährleisten.
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Gründungstätigkeit in Deutschland 2019: erster Anstieg seit 5 Jahren – 2020 im Schatten der Corona-Pandemie
Gestützt durch die Entwicklung von Konjunktur und Arbeitsmarkt konnte die Gründungstätigkeit in Deutschland 2019 erstmals seit Jahren wieder anziehen. Die Zahl der Existenzgründungen ist auf 605.000 gestiegen (+58.000). Maßgeblich dafür war ein deutliches Plus bei den Nebenerwerbsgründungen, bei den Vollerwerbsgründungen ging es dagegen abwärts auf einen neuen Tiefpunkt. Dabei konnte die Zahl der Chancengründungen auf 439.000 überproportional zulegen. Auch internetbasierte und digitale Gründungen gab es deutlich mehr. Der Ausblick für die Gründungstätigkeit 2020 war positiv – die Corona-Pandemie verändert aber einiges. Viele Gründungspläne, von denen es erneut mehr gab, dürften nun verschoben werden. Allerdings sind krisenbedingt mehr Notgründungen zu erwarten.
KfW-Gründungsmonitor 2020(PDF, 643 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Ohne ausreichendes Gegensteuern kann das Wirtschaftswachstum durch Corona-Krise und Fachkräftemangel schon bis 2030 deutlich abnehmen und bis 2040 gegen Null tendieren. Die Auswirkungen dieser Entwicklung würden auch sozial Bedürftige und Geringverdiener treffen. Auch die Akzeptanz für Investitionen in den Klimaschutz könnte darunter leiden. Wachstumsstärkende Investitionen, Innovationen, Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen können dies verhindern – doch sie brauchen Zeit. Deshalb ist es geboten, das Notwendige früh genug einzuleiten.
Corona-Krise und Fachkräftemangel bremsen das Wachstum(PDF, 323 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Fachkräfte in Deutschland
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Fokus Volkswirtschaft
Dem Druck der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt kann sich auch die Berufsausbildung in Deutschland nicht entziehen: Leiden die Ausbildungsbetriebe, hat das Folgen für das Angebot an Ausbildungs- und Übernahmekapazitäten für Absolventen. Gerade mit Blick auf die Fachkräftesituation in Deutschland gilt es deshalb, den aktuellen Krisenschock nicht auf die Berufsbildung durchschlagen zu lassen. Deutschland braucht gut ausgebildete Fachkräfte, je eher desto besser. Eine „verlorene Generation“ an Absolventen kann und darf man sich nicht leisten.
Weitere Informationen zu Fachkräfte für Deutschland
Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Fokus Volkswirtschaft
Leichte Entspannung bei der Anzahl kurzfristig angedachter Unternehmensnachfolgen im Mittelstand: Rund 152.000 Inhaber von KMU wollen bis Ende 2021 ihr Unternehmen in die Hände eines Nachfolgers legen. Das zeigen jüngste Daten des KfW-Mittelstandspanels. Eine Ursache der aktuellen Entlastung ist das gestiegene Interesse bei Existenzgründern zur Übernahme bestehender Unternehmen. Zudem haben mehr Unternehmen bereits eine Nachfolgelösung im Gepäck. Familieninterne Nachfolgen verlieren weiter an Bedeutung. Hingegen wird der Wunsch nach externen Käufern immer stärker. Auch die Preiserwartungen der Inhaber ziehen wiederholt leicht an. Perspektivisch wird der demografische Wandel den Bedarf an Nachfolgern erhöhen. Einer wachsenden Zahl übergabewilliger Inhaber wird eine schrumpfende Zahl potenzieller Übernehmer gegenüberstehen. Die nachrückenden Unternehmergenerationen sind zu dünn besetzt.
Fokus Volkswirtschaft
Der demografische Wandel treibt den Bedarf an barrierearmem Wohnraum. Aktuell gibt es ca. 3 Mio. Haushalte mit Mobilitätseinschränkungen, im Jahr 2035 werden es 3,7 Mio. sein. Doch nur 560.000 Wohnungen sind barrierearm. Um die enorme Versorgungslücke zu verringern, setzt die KfW mit dem Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ Investitionsanreize. In den Jahren 2014–2018 wurden mit Förderkrediten und Investitionszuschüssen insgesamt 190.000 Wohnungen umgebaut. Eine aktuelle Evaluationsstudie bewertet die Förderung als effektiv: Es werden mit Abstand am häufigsten die Maßnahmen durchgeführt, die laut Forschungsliteratur zentral für die Unfallvermeidung und eine selbstständige Alltagsbewältigung sind – Schwellenabbau und altersgerechte Badezimmer. Zudem wird die zentrale Zielgruppe mit Mobilitätseinschränkungen sehr gut erreicht – was insbesondere auf die für ältere und einkommensschwache Haushalte geeignete Zuschussförderung zurückzuführen ist.
Zur Themenseite Evaluation Altersgerecht Umbauen
Fokus Volkswirtschaft
Ein Drittel der KMU kann seinen Bedarf an Digitalkompetenzen nicht decken. Das Problem betrifft sowohl digitale Grundkompetenzen wie z. B. die Bedienung von Standardsoftware und digitalen Endgeräten als auch fortgeschrittene Kompetenzen wie Programmieren und statistische Datenanalyse. Die meisten KMU versuchen Digitalkompetenzen durch Weiterbildung aufzubauen. Allerdings dominieren kurze Weiterbildungsmaßnahmen mit oft begrenzter Qualifikationswirkung. Intensiverer Weiterbildung stehen vor allem finanzielle Hürden im Weg: Ein Drittel der KMU bezeichnet die direkten Kosten als Problem, ein Viertel den Arbeitsausfall abwesender Mitarbeiter. Digitale Lernformate ermöglichen flexibleres Lernen und haben deshalb das Potenzial, die berufliche Weiterbildung im Mittelstand künftig zu beleben.
Der Anteil von Frauen in den Chefetagen des Mittelstands hat seine Talfahrt vorerst beendet und ist zuletzt leicht gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels. Im Jahr 2018 wurden 16,1 % der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland von einer Frau an der Spitze geführt. Etwa 85 % der Inhaberinnen führt ein Dienstleistungsunternehmen. Auftrieb hat dem Chefinnenanteil dabei der jüngste Zuwachs bei Existenzgründungen durch Frauen gegeben. Insgesamt sitzt bei rund 613.000 Mittelständlern derzeit eine Frau im Chefsessel.
PDF-Download:
Volkswirtschaft Kompakt
Im gerade beendeten Ausbildungsjahr 2018 ist die Zahl der Ausbildungsverträge zum zweiten Mal in Folge leicht gestiegen – um 1,2 % auf 521.900, wie das Statistische Bundesamt meldet. Doch bereits im neuen Ausbildungsjahr 2019 dürfte sich die Lage wieder ändern: Eine Vorabauswertung des aktuellen KfW-Mittelstandspanels zeigt, dass unter den mittelständischen Ausbildungsunternehmen 21 % von einem Rückgang ihrer Azubi-Zahl im Jahr 2019 ausgehen. Nur 13 % rechnen hingegen mit einem Anstieg.
Azubi-Zuwachs ist nur Momentaufnahme(PDF, 288 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
In Deutschland und vielen anderen Industrienationen schwindet der Gründergeist: Der Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit geht zurück. Der weichende Gründergeist ist auch ein Resultat der demografischen Alterung. Denn das Gründungsinteresse nimmt mit dem Lebensalter ab. Erfreulich ist aber, dass unter Jüngeren der Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit zuletzt wieder zunahm. Dabei zeigt sich, dass sich Männer in allen betrachteten Ländern häufiger für die Selbstständigkeit entscheiden würden als Frauen. Die Stärkung des Gründungsinteresses von Frauen ist daher ein Schlüssel für eine nachhaltige Stabilisierung der Gründungstätigkeit in Deutschland.
Volkswirtschaft Kompakt
Den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mangelt es durch den langjährigen Arbeitsmarktboom an Fachkräften. Zwei Drittel der KMU, die Fachkräfte einstellen wollen, befürchten Schwierigkeiten. Wie eine Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zeigt, sind die Fachkräfteengpässe auf dem Land gravierender als in den großen Städten. Städte sind für viele Arbeitnehmer attraktiver: 44 % der KMU in kreisfreien Großstädten haben Pendler in der Belegschaft, 19 % Prozent haben Mitarbeiter, die extra für den Job zugezogen sind. Diese Anteile sind bei den KMU mit Sitz in den Landkreisen nur gut halb so groß. Doch abgesehen vom allgemeinen Standortvorteil bemühen sich die städtischen KMU aber auch häufiger um Fachkräfte aus anderen Regionen: In den Großstädten rekrutieren 37 % der KMU überregional, in den Landkreisen nur 20 %. Im Wettbewerb um Fachkräfte setzen vor allem die städtischen KMU neben finanziellen Anreizen und flexiblen Arbeitsbedingungen auf die Vermittlung von Wohnraum und Kitaplätzen.
Evaluationen
Eine aktuelle Evaluationsstudie zeigt: Der KfW-Studienkredit erreicht seine zentralen Zielgruppen. Dies sind Studierende, die bisher an den Hochschulen unterrepräsentiert sind – auch wegen finanzieller Hürden. Besonders stark nachgefragt wird der Kredit von Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern und Studierenden mit Berufsausbildung. Der KfW-Studienkredit gleicht Engpässe aus und deckt im Durchschnitt die Hälfte der Lebenshaltungskosten. Für drei Viertel der Befragten wäre nach eigener Aussage das Studium ohne KfW-Studienkredit unmöglich.
Im Vergleich zur Gesamtheit der Studierenden richten die Kreditnehmer ihr Studium stärker nach Arbeitsmarktgesichtspunkten aus. Der zügige und erfolgreiche Abschluss steht im Vordergrund, die Abbruchquote ist sehr niedrig. Der Arbeitsmarkteinstieg gelingt den Kreditnehmern erfolgreicher als den Absolventen insgesamt: Sie sind häufiger erwerbstätig, zudem häufiger unbefristet – und erzielen schon kurz nach dem Abschluss höhere Einkommen.
Weitere Informationen zum Thema Evaluation KfW-Studienkredit
Gründungstätigkeit in Deutschland stabilisiert sich:
Zwischenhalt oder Ende der Talfahrt?
Gestützt durch die gute Binnenkonjunktur hat sich die seit Jahren rückläufige Gründungstätigkeit in Deutschland 2018 stabilisiert. Die Zahl der Existenzgründer ist mit 547.000 im Vergleich zum Vorjahr nur noch leicht gesunken. Dabei ist die Zahl der Existenzgründungen durch Frauen gestiegen, während Existenzgründungen durch Männer weiter rückläufig sind. Die Gründungstätigkeit wird von Neugründungen dominiert. Im Jahr 2018 waren es so viele wie nie: 8 von 10 Existenzgründern machten sich selbstständig, indem sie unternehmerische Strukturen erstmalig aufbauten. Aber auch bei Existenzgründungen durch Übernahmen bestehender Unternehmen ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Der durchschnittliche Kapitaleinsatz von Gründern ist in der letzten Dekade merklich gestiegen. Insbesondere Vollerwerbsgründer setzen größere Summen ein. Insgesamt bleibt die Gründungsfinanzierung aber eine Herausforderung, an der bereits viele Gründungsplaner scheitern.
Fokus Volkswirtschaft
Eine neue Studie von KfW Research hat populäre Thesen zu den Arbeitsmarktwirkungen der Digitalisierung einem Faktencheck unterzogen. Zentrale Befunde: Die negativen Auswirkungen werden in der öffentlichen Debatte oft übertrieben, das weckt unnötige Ängste. Der Strukturwandel hat sich in den letzten Jahrzehnten verlangsamt. Das hat hohe Arbeitsplatzsicherheit geschaffen. Ein Schwinden der Arbeitseinkommen durch Automatisierung ist für die nahe Zukunft unwahrscheinlich. Leider werden auch die positiven Effekte überzeichnet. Angesichts der demografischen Entwicklung ist das schwache Wachstum der Arbeitsproduktivität bedenklich. Digitalisierung und Automatisierung bieten die Chance, die Produktivitätsschwäche zu überwinden. Dazu bedarf es jedoch des Abbaus von Investitions- und Innovationsdefiziten sowie einer digitalen Bildungsinitiative, die auch den hohen Anteil Geringqualifizierter reduziert.
Digitalisierung: Viel Lärm um nichts oder kommt da noch was?(PDF, 382 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Digitalisierung und Zukunft der Arbeit
Fokus Volkswirtschaft
Drei Viertel der Bevölkerung zwischen 18 und 67 Jahren stehen der Zuwanderung von Fachkräften grundsätzlich positiv gegenüber. Dies zeigt eine repräsentative Befragung von KfW Research: 44 % der Erwerbsbevölkerung sind der Meinung, dass Deutschland sich stärker als bisher um ausländische Fachkräfte bemühen sollte, 30 % sind für gleich bleibende Bemühungen, 21 % für geringere. Akademiker, Gutverdiener und Selbstständige sind überdurchschnittlich häufig für mehr Fachkräftezuwanderung – Arbeitslose hingegen seltener. Auch im ländlichen Raum und in Ostdeutschland sehen weniger Menschen Bedarf an ausländischen Fachkräften.
Fokus Volkswirtschaft
Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist stärker als anderswo von der Angst vor dem Scheitern gehemmt. Die gute Nachricht ist aber, dass diese Angst langsam schwindet. Hinter der Angst vor dem Scheitern verbirgt sich in erster Linie die Angst vor finanziellen Belastungen im Fall der Fälle. Dagegen spielt die Angst vor Stigmatisierung, anders als oft angenommen, kaum eine Rolle. Das finanzielle Risiko ist Teil der unternehmerischen Selbstständigkeit und darf nicht ignoriert werden. Eine stärkere Vermittlung unternehmerischer und ökonomischer Kenntnisse könnte potenziellen Gründern aber dabei helfen, dieses Risiko besser einzuschätzen und die Angst ein Stück weit zu nehmen – eine Bildungsgrundlage, die schon früh geschaffen werden sollte.
Fokus Volkswirtschaft
Rund 227.000 Inhaber im Mittelstand wollen bis Ende 2020 ihr Unternehmen in die Hände eines Nachfolgers legen. Das zeigen jüngste Daten des KfW-Mittelstandspanels. Über ein Drittel dieser Unternehmen haben bereits erfolgreich einen Nachfolger gefunden. Ein weiteres Viertel befindet sich derzeit in konkreten Verhandlungen. Das Bewusstsein der aktuellen Inhabergeneration, sich den Herausforderungen des Generationenwechsels frühzeitig zu stellen, ist generell gestiegen. Dabei sind Nachfolgevarianten außerhalb der Familie auf dem Vormarsch. Ertragskraft, Profitabilität und Eigenkapitalausstattung der meisten Nachfolgeplaner sind solide. Dennoch wird nicht allen Unternehmen eine Übergabe gelingen. Speziell für 36.000 KMU wird die Zeit knapp. Sie streben eine Unternehmensnachfolge in den kommenden zwei Jahren an, haben aber noch keinerlei Aktivitäten unternommen. Zudem besteht der zentrale Engpass nach wie vor: Die nachrückende Unternehmergeneration ist zu dünn besetzt.
Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau(PDF, 757 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Migranten sind überdurchschnittlich gründungsaktiv. Zum einen ist unter Migranten der Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit stärker, zum anderen haben sie im Mittel schlechtere Berufsabschlüsse und dadurch schlechtere Arbeitsmarktchancen. Migranten gründen außerdem anders: mit mehr Mitarbeitern und einem Branchenschwerpunkt in den persönlichen Dienstleistungen. Bestimmte Gründungsprobleme, etwa bei der Finanzierung, nehmen sie stärker wahr. All diese Muster sind noch etwas stärker ausgeprägt unter Migranten, die in einem fremdsprachigen Haushalt leben. Hier spielen sprachliche Hürden eine Rolle – ihr Abbau braucht Zeit und ausreichend Unterstützung.
Gründungen durch Migranten: größerer Wunsch nach Selbstständigkeit(PDF, 240 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
In Deutschland gab es im Jahr 2017 rund 154.000 „junge“ Sozialunternehmer mit 108.000 Sozialunternehmen. Das entspricht einem Anteil von 9 % an allen Jungunternehmern. Sozialunternehmer haben neben dem Gewinnziel ein soziales oder ökologisches Anliegen ganz oben in ihrem Zielsystem verankert und verzichten dafür auf mögliche Rendite. Sie beschreiten auch darüber hinaus gerne neue Wege: Knapp ein Drittel der jungen Sozialunternehmer bieten Marktneuheiten an, die es auf ihrem Zielmarkt vorher noch nicht gab und jeder Vierte entwickelt eigene technologische Innovationen bis zur Marktreife. Viele der so genannten ‚Social Entrepreneurs‘ sind also Vorreiter für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Bei Älteren ist der Anteil von Sozialunternehmern überdurchschnittlich hoch. Sie zeigen somit, dass man auch im fortgeschrittenen Berufsleben neue Pläne verwirklichen kann – das ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu begrüßen. Sozialunternehmer befürchten häufiger Defizite in ihren kaufmännischen Kenntnissen. Sie sollten daher bei der kaufmännischen Qualifizierung unterstützt werden.


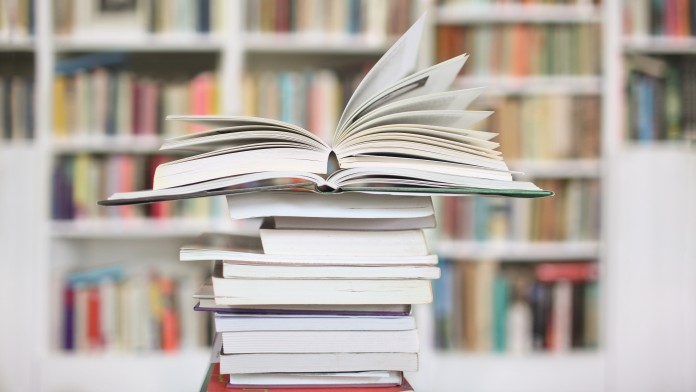
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw.de/s/dekBbrjZ
Link kopieren Link kopiert