
KfW Research
Kommunen und InfrastrukturDas aktuelle KfW-Kommunalpanel zum Download
Der wahrgenommene Investitionsrückstand der deutschen Kommunen ist im Jahr 2024 um 15,9 % auf einen Rekordwert von 215,7 Mrd. EUR gestiegen. Diese Zahl verdeutlicht den wachsenden Investitionsstau, den die Kommunen bewältigen müssen, um ihre Infrastruktur in Qualität und Quantität wieder in einen adäquaten Zustand zu bringen. Den größten Investitionsrückstand sehen die Kommunen einmal mehr bei den Schulgebäuden. Hier beträgt die Lücke 67,8 Mrd. EUR oder 31 % des gesamten Investitionsstaus. Darauf folgt die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur mit 53,4 Mrd. EUR oder 25 % des Investitionsrückstands. Angesichts des Rekorddefizits von 24,3 Mrd. EUR in den Kassen der Kommunen geben 19 % der Kommunen an, den Unterhalt ihrer Infrastruktur nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr leisten zu können, was den Sanierungsstau noch verschärfen dürfte.
KfW-Kommunalpanel 2025(PDF, 2 MB, barrierefrei)
Weitere Informationen auf der Themenseite KfW-Kommunalpanel
Fokus Volkswirtschaft
Die ersten Ergebnisse der deutschlandweiten Befragung des KfW-Kommunalpanels 2025 zeigen, dass sich die Haushaltslage in vielen Kommunen im letzten Jahr verschlechtert hat. Besonders betroffen sind größere Städte. Damit spiegeln die Ergebnisse die schwierige Kassenlage vieler Kommunen wider, die im vergangenen Jahr ein Rekorddefizit eingefahren haben. Auch die Erwartungen für die zukünftige finanzielle Entwicklung sind überwiegend negativ. Die vergangenen kommunalen Haushaltsdefizite führten oft zu einem Rückgang der Bauinvestitionen, und die aktuelle negative Stimmung in den Kämmereien lässt befürchten, dass dies in den kommenden Jahren erneut der Fall sein könnte. Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die neue Regierung im Hinblick auf das Sondervermögen konkret ergreift und ob die notwendigen Investitionen effizient umgesetzt werden können.
Fokus Volkswirtschaft
Kommunen und ihre Investitionen in Sportstätten bilden eine zentrale Säule der Sportinfrastruktur. Laut der Sonderbefragung im Rahmen des KfW-Kommunalpanels finden sich Sporthallen und Sportplätze jeweils in über 90 % der teilnehmenden Kommunen, Schwimmbäder in rund der Hälfte. Aber viele Kommunen können den Unterhalt der Sportstätten nicht in vollem Umfang leisten. Daraus ergeben sich zum Teil erhebliche Investitionsrückstände, vor allem bei Sport- und Schwimmhallen, bei denen jeweils über 50 % der Kommunen einen mindestens nennenswerten Rückstand vermelden. Während das Sportangebot aktuell in der Hälfte der teilnehmenden Kommunen uneingeschränkt möglich ist, zeichnen sich bei anderen Kommunen Einschränkungen ab. Vor allem bei den Bädern ist ohne Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren mit Schließungen zu rechnen. Um die Investitionsrückstände im Sport abzubauen, befürworten 76 % der Kommunen eine Verbesserung der Grundfinanzierung.
Kommunale Sportstätten: große Bedeutung und hoher Investitionsbedarf(PDF, 472 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Verwaltungsgebäude wie Rathäuser und Bürgerämter haben eine hohe Bedeutung für die Kommunen und werden deshalb in einem Sonderthema des KfW-Kommunalpanels 2024 eingehend beleuchtet. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Gebäude aber nur eine geringe kommunalpolitische Priorität besitzen. Dies ist insofern problematisch, weil auf sie mit 18,8 Mrd. EUR der drittgrößte Anteil des wahrgenommenen Investitionsrückstands der Kommunen entfällt. Neben Nachholbedarfen sind zudem investive Mehrbedarfe absehbar, da die Gebäude Dreh- und Angelpunkt der Energie- und Wärmewende sind oder weil sich – in einer von fünf Kommunen – künftig der Büroflächenbedarf erhöhen wird. Ihr Zustand hat zudem Rückwirkungen auf die Motivation und die Gewinnung neuer Verwaltungsmitarbeitender. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, ist es sinnvoll, die Gebäude in den kommunalen Investitionsnotwendigkeiten stärker zu priorisieren und Investitionshemmnisse gezielt zu adressieren.
Hohe kommunale Investitionsbedarfe in öffentlichen Verwaltungsgebäuden(PDF, 281 KB, barrierefrei)
Das KfW-Kommunalpanel 2024 zeigt eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den Kämmereien. Die Bewertungen der aktuellen und künftigen Finanzlage sind zunehmend pessimistisch. Insbesondere die steigenden Ausgaben bei den Sozial-, Personal- und Sachkosten sind langfristige Herausforderung für die Kommunalhaushalte und verringern die kommunalen Investitionsspielräume. Obwohl die Investitionen im vergangenen Jahr noch einmal leicht stiegen, reichte dieses Wachstum nicht aus, um die Bedarfs- und Preissteigerungen auszugleichen. In der Folge steigt der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen weiter. Die Planung, Umsetzung und Finanzierung kommunaler Investitionen wird durch verschiedene monetäre und nicht-monetäre Investitionshemmnisse erschwert. Langfristig höhere Investitionen erfordern einen Abbau dieser Hürden, z. B. durch schlankere Vergabeprozesse, flexiblere Bauvorschriften und eine breitere Finanzierungsbasis für kommunale Investitionen.
KfW-Kommunalpanel 2024(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen auf der Themenseite KfW-Kommunalpanel
Trotz der aktuellen Mehrfachkrise und der negativen Prognosen, die daraus für die kommunalen Finanzen abgeleitet wurden, sind die Angaben der Kämmereien im KfW-Kommunalpanel 2023 von Stabilität gekennzeichnet. Sowohl die aktuelle Finanzlage als auch die Investitionen zeigen sich robust, der wahrgenommene Investitionsrückstand wächst nur moderat und die Finanzierungsmöglichkeiten sind trotz Zinswende noch auskömmlich. Zahlreiche Haushaltsrisiken wie hohe Preissteigerungen und steigende Zinsen trüben jedoch die Erwartungen der Kommunen hinsichtlich der künftigen Finanzlage und der Finanzierungskonditionen spürbar ein. Angesichts dieser Unsicherheiten drohen die die transformativen Aufgaben der Kommunen ins Hintertreffen zu geraten. Einmal mehr wird deutlich, dass die fragilen Kommunalhaushalte eine plan- und kraftvolle öffentliche Investitionsoffensive in Deutschland erschweren.
KfW-Kommunalpanel 2023(PDF, 906 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen auf der Themenseite KfW-Kommunalpanel
Fokus Volkswirtschaft
Im diesjährigen Sonderthema geht das KfW-Kommunalpanel 2023 auf den Klimaschutz und die Anpassungen an den Klimawandel als die derzeit wahrscheinlich größte transformative Notwendigkeit für die Kommunen ein. Die Angaben der Städte, Gemeinden und Landkreise zeigen, dass knapp 3 Mrd. EUR im Kernhaushalt sowie weitere 2 Mrd. EUR in den ausgelagerten Einheiten und damit rund 15 % der geplanten Investitionen auf den Klimaschutz entfallen. Mit rund 1 Mrd. EUR im Kernhaushalt und einer halben Milliarde in den Auslagerungen werden weniger als 4 % der geplanten Investitionen für Maßnahmen zur Klimaanpassung verwendet. Über die Hälfte der Kommunen geht von zukünftig steigenden Investitionen in Klimaschutz und -anpassung aus. Es deutet sich allerdings an, dass dieses Investitionswachstum nicht reichen wird, um die Klimaziele zu erreichen. Zudem gehen 51 % der Kämmereien davon aus, dass der bestehende Finanzierungsmix nicht geeignet sein wird, die höheren Investitionsbedarfe zu decken.
Weitere Publikationen zum Thema Klimaneutralität
Im Vorfeld der Hauptbefragung zum KfW-Kommunalpanel wurde das Deutsche Institut für Urbanistik mit einer Vorstudie beauftragt, bei den Kämmereien den Informationsstand zu den kommunalen Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung zu ermitteln.
Sondergutachten im Rahmen des KfW-Kommunalpanels(PDF, 1 MB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Bürokratie wird in Befragungen regelmäßig als Gründungshemmnis genannt. Wo bei (angehenden) jungen Selbstständigen der Schuh genau drückt, hat sich bei einer Befragung auf gruenderplattform.de gezeigt: Bürokratie wird zum Hemmnis, wenn öffentliche Institutionen zu komplex, zu langsam, zu analog, zu wenig hilfreich und zu wenig erreichbar sind. Insbesondere die Verringerung von Komplexität durch einfache und eindeutige Kriterien sowie eine institutionenübergreifende Harmonisierung und Digitalisierung sind daher vielversprechende Ansätze, um Bürokratie als Gründungshemmnis zu verringern.
Dreiklang des Bürokratieabbaus: einfacher, schneller, digitaler(PDF, 238 KB, barrierefrei)
Weitere Analysen und Informationen in unserem Dossier Existenzgründungen
Fokus Volkswirtschaft
Die Zinswende verteuert die öffentliche Schuldenaufnahme, nachdem in der vorangegangenen Niedrigzinsphase die Zinsbelastung spürbar gesunken war. Mit steigenden Anteilen an den Ausgaben könnten die Kreditkosten den finanziellen Spielraum für Investitionen wieder verringern. Gerade im Hinblick auf die transformativen Anforderungen an die Kommunen würde dies den investiven Aufholprozess erschweren. Eine Analyse der Refinanzierungsbedarfe zeigt allerdings große Unterschiede zwischen den Kommunen, die daher sehr ungleich von den steigenden Zinsen betroffen sind. Für die allermeisten Kommunen stellen andere Herausforderungen wie z. B. die gestiegenen Baupreise höhere Hürden dar. Eine Entlastung bei den Zinslasten sollte sich daher auf den überschaubaren Kreis der besonders betroffenen Kommunen konzentrieren. In jedem Fall hilfreich für alle Städte, Gemeinden und Landkreise wäre eine strukturelle Verbesserung des Kommunalfinanzsystems, um die erforderlichen Investitionen stemmen zu können.
Volkswirtschaft Kompakt
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, investieren die deutschen Kommunen seit mehreren Jahren verstärkt in ihre Kindertageseinrichtungen. Laut bundesweiter Hochrechnung im KfW-Kommunalpanel 2022 liegen die geplanten Investitionen für Kitas bei 3,2 Mrd. EUR, etwas weniger als in den Vorjahren. Dieses Investitionsniveau ist nicht ausreichend, um die steigenden Bedarfe zu erfüllen. Daher steigt der wahrgenommene Investitionsrückstand auf nun 10,5 Mrd. EUR. Die Kommunen sind allerdings tendenziell optimistisch, die Investitionslücke zukünftig etwas schließen zu können, sofern die Finanzlage nicht durch die verschiedenen Krisen wieder in Mitleidenschaft gezogen wird.
Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die Energiekrise erschüttern die Grundfesten einer regelbasierten Weltordnung und des deutschen Wirtschaftsmodells. Über ein kurzfristiges Krisenmanagement hinaus sind Investitionen der Schlüssel für eine erfolgreiche Anpassung an das veränderte Umfeld. Sie ermöglichen den Umbau der Energieversorgung sowie die grüne und digitale Transformation - und verlangen gemeinsame Kraftanstrengungen von Staat, Unternehmen und privaten Haushalten. Der Löwenanteil der Investitionen muss vom Privatsektor kommen. Die aktuellen Energiekostenbelastungen und Unsicherheiten wirken indes hemmend. Umso wichtiger ist es, die private Investitionstätigkeit anzuregen und intelligent zu unterstützen. Dem Staat fällt dabei eine zentrale Rolle zu für die Formulierung von Zielbildern und das Setzen von Rahmenbedingungen und Anreizen, aber auch als Investor in Infrastruktur und Humankapital, die für die produktive Entfaltung privater Aktivitäten notwendig sind.
Ein Investitionsschub für die Transformation – was ist konkret nötig?(PDF, 229 KB, barrierefrei)
Zum Dossier Investitionen in Deutschland
Zur Themenseite Die Corona-Krise – Auswirkungen und Impulse für eine nachhaltige Erholung
Volkswirtschaft Kompakt
Auch die deutschen Kommunen werden von den steigenden Energiepreisen in Mitleidenschaft gezogen, sodass Maßnahmen im Energiebereich ergriffen werden müssen. Schon vor der aktuellen Krise haben die Städte, Gemeinden und Landkreise viele Schritte unternommen, um sich bei Energieerzeugung wie -nutzung nachhaltiger aufzustellen. Neben dem Ziel des Klimaschutzes geht es dabei auch um die Vermeidung hoher Energiekosten. Der beste Weg dahin ist die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Hierfür haben über 80 % der Kommunen in PV-Anlagen oder die energetische Sanierung ihrer Gebäude investiert. Deutlich weniger Maßnahmen wurden z. B. in den Bereichen Wind und Wärme ergriffen, wie aus den Ergebnissen einer Nachbefragung zum KfW-Kommunalpanel hervorgeht. Die aktuelle Krise kann daher Anlass sein, das kommunale Engagement in der Energiewende zu stärken.
Ansätze in Kommunen, um nachhaltiger und unabhängiger Energie zu nutzen(PDF, 136 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Bildung ist eine zentrale Säule des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Moderne Schulgebäude sind eine wesentliche Voraussetzung für ein leistungsfähiges Bildungssystems. Die seit Jahren hohen Investitionsrückstände im Schulbereich geben deshalb Anlass zur Sorge. Gegenwärtig ist dabei weniger das absolute Niveau der Rückstände problematisch, das in nominalen Größen in den vergangenen Jahren sogar gesunken ist. Vielmehr sind die sich scheinbar verstärkenden regionalen Unterschiede bei der Schulinfrastruktur im Blick zu behalten. Deshalb gilt es die Investitionsfähigkeit der Kommunen in allen Regionen sicher zu stellen, damit zentrale Infrastrukturbereiche wie Schulgebäude überall in einem angemessenen Umfang und Zustand bereitgestellt werden können.
Fokus Volkswirtschaft
Die öffentlichen Investitionsbedarfe zur Erreichung der Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 lassen sich auf knapp 500 Mrd. EUR schätzen, was jährlichen Klimaschutzinvestitionen von durchschnittlich rund 20 Mrd. EUR entspricht. Die größten staatlichen Bedarfe werden in den Sektoren Energie (297 Mrd. EUR), Verkehr (137 Mrd. EUR) und bei den Gebäuden (47 Mrd. EUR) anfallen. Diese Beträge sind in den öffentlichen Haushalten durchaus finanzierbar, stellen aber immerhin eine Versechsfachung des gegenwärtigen Investitionsniveaus dar. Ohne eine stringente Anpassung der Zuständigkeiten, Finanzströme und Kompetenzen zwischen den föderalen Ebenen Bund, Länder und Kommunen wird es kaum möglich sein, die nachhaltige Steigerung der erforderlichen Klimaschutzinvestitionen in Angriff zu nehmen.
Die zugrundeliegende Kurzstudie finden Sie hier:
Beitrag von Green Finance zum Erreichen von Klimaneutralität in Deutschland – Öffentlicher Anteil an Klimaschutzinvestitionen(PDF, 2 MB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Schwimmbäder zählen zu den beliebtesten, jedoch auch teuersten Sporteinrichtungen in den Kommunen. Zwischen den Regionen in Deutschland unterscheidet sich die Zahl der Bäder zum Teil beachtlich. Ein Grund sind die hohen Betriebs- und Investitionskosten, die sich nicht jeder Ort leisten kann oder möchte. Erfreulich in finanzieller Hinsicht: Die Angaben der Kämmereien im KfW-Kommunalpanel 2022 zeigen, dass für Sportstätten und Schwimmbäder mehr Investitionen geplant sind und der wahrgenommene Investitionsrückstand in der bundesweiten Hochrechnung auf 8,5 Mrd. EUR gesunken ist. Zugleich machen vor allem die steigenden Energiepreise deutlich, dass mehr als zuvor in die Energieeffizienz investiert werden muss, um dieses Angebot der Daseinsvorsorge zukunftsfest zu machen.
Investitionsrückstand bei Schwimmbädern sinkt, aber Energiekosten steigen(PDF, 161 KB, barrierefrei)
Die Krise als Dauerzustand? Kommunen durch Corona-Krise, Flutkatastrophen und Ukraine-Krieg gefordert
Das KfW-Kommunalpanel 2022 zeichnet noch die Auswirkungen der Corona-Krise und Flutkatastrophen des Jahres 2021 nach, während mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die nächsten Herausforderungen für die Kommunen bereits absehbar sind. Die zunehmenden Investitionsbedarfe führten bei deutlich teureren Baupreisen zu einem höheren Investitionsrückstand. Die Haushaltssituation hat sich hingegen trotz der verbesserten Gesamtlage in vielen Kommunen nicht nachhaltig erholt. Es wird deutlich, dass die Kommunalfinanzen nicht resilient genug sind, damit Städte, Gemeinden und Landkreise die an sie gestellten Anforderungen ohne größere Leistungsbeeinträchtigungen auch in Krisenzeiten bewältigen können.
Fokus Volkswirtschaft
In einer ergänzenden Ad-hoc-Umfrage zum KfW-Kommunalpanel 2022 wurden knapp 200 Kommunen im Auftrag von KfW Research durch das Deutsche Institut für Urbanistik hinsichtlich der Auswirkungen steigender Energiepreise befragt. Es zeigt sich, dass im Durchschnitt rund 2 % der Ausgaben mittlerweile nur für Energiekosten ausgegeben werden müssen. Über die Hälfte der befragten Kommunen kann diesen Anstieg nur schwer oder sogar gar nicht schultern, sodass verschiedene Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Die meisten Kommunen streben mehr Investitionen in die Energieeffizienz an, viele Kommunen müssen jedoch auch mehr Schulden oder Kürzungen bei anderen Haushaltsposten ins Auge fassen.
Kommunen spüren steigende Energiepreise und reagieren vielfältig darauf(PDF, 152 KB, barrierefrei)
Volkswirtschaft Kompakt
In einer Vorabveröffentlichung zum KfW-Kommunalpanel 2022 zeigen die deutschlandweiten Befragungsergebnisse, dass die Kommunen ihre Finanzlage infolge der Corona-Krise deutlich schlechter bewerten als noch im Vorjahr. Auch die zukünftige finanzielle Situation wird von der Mehrzahl der befragten Städte, Gemeinden und Landkreise negativ gesehen, selbst wenn die Anzahl der Kommunen, die eine Verbesserung erwarten, leicht zugenommen hat.
Fokus Volkswirtschaft
Öffentliche Investitionen in die Infrastruktur oder zur Bewältigung der großen transformativen Herausforderungen mit Blick auf Klimawandel und Digitalisierung setzen eine leistungsfähige Verwaltung der Kommunen voraus. Insbesondere in den Bau- und Planungsbereichen hat die Personalknappheit ein besorgniserregendes Niveau erreicht, weil die Umsetzung der dringend benötigten zusätzlichen Investitionen kaum noch gestemmt werden kann. Dieses Problem wird durch die Altersstruktur zukünftig verschärft, weil ein massiver Verlust der aktiven Belegschaft in die Rente und Pension absehbar ist. Um die Personallücke auch nur im Ansatz zu schließen, ist ein entschiedenes Gegensteuern an vielen Ansatzpunkten der Personalpolitik für den öffentlichen Dienst der Kommunen geboten.
Knappe Personalkapazitäten erschweren Ausweitung kommunaler Investitionen(PDF, 245 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die hohen und wachsenden Investitionsbedarfe auf Ebene der Kommunen erfordern eine Ausdehnung öffentlicher Investitionen. Trotz höherer Investitionsausgaben wurde jedoch zuletzt nicht in gleichem Maße ein Mehr an moderner Infrastruktur bereitgestellt, sondern auch steigende Baupreise bedient. Auf der Finanzierungsseite konnten niedrige Zinsen immerhin zu einer Entlastung beitragen, allerdings nicht im Umfang der höheren Baupreise. Mit Blick auf die Zukunft ist davon auszugehen, dass die Baupreise hoch bleiben, die Finanzierungskonditionen sich aber langsam verschlechtern könnten. Somit wird die Ausweitung der kommunalen Investitionen schwieriger als sie eh schon ist und erfordert ein entschlossenes Gegensteuern der politischen Akteure auf allen föderalen Ebenen.
Baupreisanstieg und mögliche Zinswende: Hürden für Kommunalinvestitionen(PDF, 167 KB, barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und die enormen Investitionsbedarfe für die großen gesellschaftlichen Transformationen wie Klimaschutz, Digitalisierung und demografischer Wandel bringen neue Herausforderungen für die Kommunen mit sich. Die Frage der Finanzierung ist dabei eine der drängendsten offenen Baustellen. Nur aus den laufenden Haushalten werden die Investitionen nicht zu bezahlen sein, daher wird vor allem der Kommunalkredit eine wichtige Rolle spielen. Der Verschuldung der Städte, Gemeinden und Landkreise sind aber Grenzen gesetzt. Ohne eine strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung wird Deutschland die anstehenden Zukunftsinvestitionen darum nicht bewältigen können.
Fokus Volkswirtschaft
Die Digitalisierung in Schulen war für die kommunalen Schulträger schon vor Corona ein wichtiges Thema. Die Corona-Krise hat nun Defizite und Potenziale der Digitalisierung deutlich gemacht und zwingt alle Beteiligten, mehr Tempo an den Tag zu legen. Der größte Handlungsbedarf besteht aktuell bei Lernplattformen und Cloudlösungen, um den digitalen Unterricht zu erleichtern. Als bedeutendes Hindernis stellt sich der Mangel an ausreichend qualifiziertem Personal für die Kommunen als Schulträger dar. Um die Digitalisierung in den Schulen dauerhaft und nachhaltig voranzubringen, fehlt den Kommunen die finanzielle Planungssicherheit, denn die gerade zu Anfang anfallenden Kosten sind beachtlich. Die Investitionsbedarfe werden allerdings dauerhaft bedeutsam sein, wie die Ergebnisse einer Umfrage unter den Kommunen zeigen.
Präsentation zur Ad hoc Umfrage "Digitalisierung in Schulen"(PDF, 421 KB, nicht barrierefrei)
Weitere Informationen zum Thema Kommunale Investitionen in die Bildung
Fokus Volkswirtschaft
Die Investitionsbedarfe für die klimaneutrale Transformation der öffentlichen Infrastruktur in den Kommunen sind hoch und werden kaum aus den laufenden Haushalten zu finanzieren sein. Mit Sustainable Finance steht am internationalen Kapitalmarkt Geld zur Verfügung, das aber bislang auf kommunaler Ebene kaum herangezogen wird, weil die üblichen Kapitalmarktinstrumente für viele Kommunen nicht geeignet sind. Es werden daher Alternativen benötigt, die sich an etablierten Instrumenten wie dem Kommunalkredit orientieren. Um jedoch dem grünen Kommunalkredit zum Durchbruch zu verhelfen, bedarf es noch einiger Weichenstellungen und Vorreiter in der Kommunalfinanzierung.
Weitere Informationen zum Thema Green Finance Kommunen
Volkswirtschaft Kompakt
Mit den Fortschritten bei den Impfungen und dem nahenden Sommer steigt die Hoffnung, dass sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten deutlich erholen werden. Der deutsche Arbeitsmarkt hat die Krise bislang vergleichsweise gut überstanden. Und ein Blick in die Vergangenheit belegt, dass sich der Arbeitsmarkt auch in zurückliegenden Krisen bereits als krisenfest gezeigt und ökonomische Schocks zügig überwunden hat; so das Ergebnis einer aktuellen Studie der Dresdner Niederlassung des ifo Instituts im Auftrag von KfW Research.
Durch die finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern konnten die Kommunen das Befragungsjahr 2020 überraschend mit einem kleinen Überschuss abschließen. Die große Unsicherheit über die weitere finanzielle Entwicklung hat jedoch das Potenzial, sowohl die öffentlichen Investitionen als auch die freiwilligen Aufgaben z. B. für Sport und Kultur in Mitleidenschaft zu ziehen. Das aktuelle KfW-Kommunalpanel 2021 verdeutlicht daher die Notwendigkeit, durch kurz- und mittelfristige Maßnahmen die Handlungsspielräume der Kommunen zu stabilisieren, damit die großen gesellschaftlichen Herausforderungen und der wahrgenommene Investitionsrückstand von nun 149 Mrd. EUR nachhaltig angegangen werden können.
Das KfW-Kommunalpanel basiert auf einer vom Deutschen Institut für Urbanistik jährlich durchgeführten repräsentativen Befragung der Kämmereien in den Städten, Gemeinden und Landkreisen und gilt als wichtige Referenzgröße in der wirtschaftspolitischen Debatte.
Fokus Volkswirtschaft
Der Begriff Resilienz hat in den letzten Jahren eine rasante Karriere hingelegt. Auch im kommunalen Raum findet das Schlagwort zunehmend Beachtung. Nachdem es dabei vor allem um die Frage des Umgangs mit Klimaschäden ging, sind jetzt auch die Folgen der Corona-Krise beispielsweise für die Leistungsfähigkeit der Verwaltung, die Zukunft der Innenstädte oder den Verkehr hinzu gekommen. Unklar bleibt dabei aber häufig, was konkret unter Resilienz zu verstehen ist. Die KfW hat darum die Dresdner Niederlassung des ifo Instituts mit einer Studie beauftragt, die Facetten des Begriffs zu beleuchten und anhand statistischer Daten zu untersuchen, wie resilient Deutschlands Regionen sind. Konkret zieht die Studie Lehren aus den Auswirkungen der Finanzkrise 2009, dem Jahrhundertsturm Lothar 1999 oder lokalen Arbeitsmarkteinbrüchen.
Fokus Volkswirtschaft
Obwohl Bund und Länder 2020 diverse Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, um die kommunalen Haushalte zu entlasten, bleibt gerade mit Blick auf die Zeit über das Jahr 2021 hinaus eine erhebliche Unsicherheit bestehen. Dies spiegelt sich auch in den Angaben der für das KfW-Kommunalpanel 2021 befragten Kommunen wider. Die Ergebnisse einer Vorabauswertung zeigen, dass bei kommunalen Investitionen und freiwilligen Aufgaben das Risiko spürbarer Einsparungen besteht. Die Unwägbarkeiten für die öffentlichen Finanzen drohen damit langfristig negative Folgen über die Zeit der Krise hinaus zu entfalten, wenn es nicht gelingt, finanzielle Planungssicherheit für die Kommunen zu schaffen.
KfW-Kommunalpanel 2021 – Vorabauswertung Corona(PDF, 511 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Der Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung stellt schon heute eine enorme Herausforderung dar und wird zukünftig noch drängender. Die Kommunalverwaltungen betrifft dies mit am stärksten, was die Erbringung der Daseinsvorsorge in Mitleidenschaft zieht. Die Digitalisierung könnte helfen, mit weniger Personal auszukommen. Doch um die Verwaltung erfolgreich zu digitalisieren, bedarf es der richtigen personellen Expertise. Um dieses Dilemma zu lösen, muss es verschiedene Anpassungen im öffentlichen Dienst geben. Dies betrifft nicht nur das Gehalt, sondern auch die Art und Weise, wie Verwaltung arbeitet. Künftig wird weniger, dafür aber besser qualifiziertes und bezahltes Personal benötigt. Diese Umstellung der Stellenpläne wird nur gelingen, wenn verschiedene Maßnahmen in eine langfristige Personalstrategie eingebunden werden. Und damit sollte besser heute als morgen begonnen werden, denn das Problem wird sonst jeden Tag größer.
Volkswirtschaft Kompakt
Die Einführung der Doppik in vielen deutschen Kommunen seit 2009 ist mehr als eine rein technische Änderung des Rechnungswesens. Damit verbunden sind auch neue analytische Zugänge aufgrund zusätzlicher Daten und Kennziffern sowie veränderte Steuerungs- und Anreizwirkungen für die kommunale Politik und Verwaltung. Dies gilt insbesondere auch für die Investitionstätigkeit und die Finanzierung der Kommunen. Allerdings zeigt sich, dass viele der angestrebten Ziele der Umstellung auf die Doppik nicht vollständig erreicht wurden. Trotz eines beachtlichen organisatorischen, personellen und finanziellen Aufwands, der in den letzten Jahren betrieben wurde, bleibt somit noch viel Potenzial des neuen Buchführungssystems ungenutzt. Gerade in Zeiten sich wieder verschlechternder Haushaltslagen sollte hieran angesetzt werden, um mehr Effizienz bei der Mittelverwendung im öffentlichen Bereich zu befördern.
Fokus Volkswirtschaft
Nicht erst durch die Corona-Krise sind einer breiten Öffentlichkeit die Nachholbedarfe, aber auch die Potenziale der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung bewusst geworden. In erster Linie sind hier die Kommunen gefordert, da sie täglich die direkte Schnittstelle zu den Bürgern bilden. Trotz viel versprechender Pilotvorhaben hat die Digitalisierung in der Fläche aber noch nicht den gewünschten Umfang erreicht. Die Bemühungen zum Ausbau des E-Governments und der IT-Infrastruktur dürften darum weiter intensiviert werden. Jedoch sollte bei allen Aktivitäten zur Förderung und Stärkung der Digitalisierung nicht aus den Augen verloren werden, dass die Kommunen jeweils ganz unterschiedliche Ziele, Bedürfnisse, Handlungsspielräume und Hemmnisse haben. Dies zeigen die Angaben im diesjährigen Sonderthema des KfW-Kommunalpanels 2020, welche in einer vertiefenden Studie von KfW Research ausgewertet wurden.
Volkswirtschaft Kompakt
Wohl nur langsam wird sich nach diesen Sommerferien der Unterricht an deutschen Schulen normalisieren. Dabei hat die Corona-Krise den Wert einer funktionierenden schulischen Infrastruktur deutlich gemacht. Für den Zustand der Schulgebäude sind zumeist die Städte, Gemeinden oder Landkreise als Schulträger zuständig. Die zuletzt gestiegenen Investitionen konnten die wachsenden Bedarfe aber nicht ausgleichen, sodass der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen für den Bereich Schulen im KfW-Kommunalpanel 2020 wieder zugenommen hat. Durch die Folgen der Corona-Krise könnten die kommunalen Investitionen nun unter Druck geraten. Die Stabilisierung der Kommunalfinanzen ist darum ein entscheidender Punkt, um die weitere Stärkung der Bildungslandschaft in Deutschland zu gewährleisten.
Die Stimmung der Kommunen hat sich mit Blick auf die Finanzlage durch die Corona-Krise massiv eingetrübt. Die Haushaltsüberschüsse der letzten Jahren dürften angesichts sinkender Einnahmen und steigender Ausgaben vorerst unerreichbar sein. In den Kämmereien geht man von Sparmaßnahmen aus, um die Haushaltsdefizite zu decken. Dies droht insbesondere die Investitionen in Mitleidenschaft zu ziehen. Dabei war das Investitionsniveau bereits 2019 nicht ausreichend, denn der wahrgenommene Investitionsrückstand ist laut bundesweiter Hochrechnung auf 147 Mrd. EUR gestiegen. Für die lokale Infrastruktur und damit die Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität in Deutschland sind das keine gute Aussichten.
An Investitionsbedarfen und Herausforderungen, diese Bedarfe zu decken, wird es den Kommunen auch in Zukunft nicht mangeln. Umso wichtiger ist deshalb das Signal, das von dem am 3. Juni beschlossenen Konjunkturpaket ausgeht und maßgeblich dazu beitragen dürfte, Kommunen nicht zuletzt bei ihren Investitionen zu unterstützen.
Das KfW-Kommunalpanel basiert auf einer vom Deutschen Institut für Urbanistik jährlich durchgeführten repräsentativen Befragung der Kämmereien in den Städten, Gemeinden und Landkreisen und gilt als wichtige Referenzgröße in der wirtschaftspolitischen Debatte in Deutschland.
Fokus Volkswirtschaft
In einer aktuellen KfW-Umfrage deuten Einschätzungen der Kommunen darauf hin, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auf die öffentlichen Haushalte einem Muster folgen, das bereits bei früheren Krisen zu beobachten war: Einnahmen sinken, Ausgaben und Schulden steigen. Den finanziellen Engpässen wird durch ein Streichen der Investitionen begegnet. Dies fällt kurzfristig kaum auf, droht aber langfristig negative Konsequenzen für den Zustand der Infrastruktur nach sich zu ziehen. Hohe Folgekosten sind ebenso absehbar wie Einschränkungen bei der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur. Für die Qualität der Daseinsvorsorge und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland sind das keine guten Aussichten.
Ergebnisse der Ergänzungsumfrage im Detail:
KfW-Kommunalpanel 2020: Ergänzungsumfrage „Corona“(PDF, 425 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Dem Druck der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt kann sich auch die Berufsausbildung in Deutschland nicht entziehen: Leiden die Ausbildungsbetriebe, hat das Folgen für das Angebot an Ausbildungs- und Übernahmekapazitäten für Absolventen. Gerade mit Blick auf die Fachkräftesituation in Deutschland gilt es deshalb, den aktuellen Krisenschock nicht auf die Berufsbildung durchschlagen zu lassen. Deutschland braucht gut ausgebildete Fachkräfte, je eher desto besser. Eine „verlorene Generation“ an Absolventen kann und darf man sich nicht leisten.
Fokus Volkswirtschaft
Der demografische Wandel treibt den Bedarf an barrierearmem Wohnraum. Aktuell gibt es ca. 3 Mio. Haushalte mit Mobilitätseinschränkungen, im Jahr 2035 werden es 3,7 Mio. sein. Doch nur 560.000 Wohnungen sind barrierearm. Um die enorme Versorgungslücke zu verringern, setzt die KfW mit dem Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ Investitionsanreize. In den Jahren 2014–2018 wurden mit Förderkrediten und Investitionszuschüssen insgesamt 190.000 Wohnungen umgebaut. Eine aktuelle Evaluationsstudie bewertet die Förderung als effektiv: Es werden mit Abstand am häufigsten die Maßnahmen durchgeführt, die laut Forschungsliteratur zentral für die Unfallvermeidung und eine selbstständige Alltagsbewältigung sind – Schwellenabbau und altersgerechte Badezimmer. Zudem wird die zentrale Zielgruppe mit Mobilitätseinschränkungen sehr gut erreicht – was insbesondere auf die für ältere und einkommensschwache Haushalte geeignete Zuschussförderung zurückzuführen ist.
Volkswirtschaft Kompakt
Die Einbruchszahlen sinken zwar seit einigen Jahren, doch nur ein Viertel des deutschen Wohnungsbestands ist ausreichend gegen Einbruch geschützt. Einbrüche verursachen nicht nur finanziellen Schaden, sondern auch psychische Verletzungen. Unterstützt durch die KfW-Förderung "Einbruchschutz" werden pro Jahr ca. 55.000 Bestandswohnungen effektiv gesichert, wie eine aktuelle Evaluationsstudie zeigt. Die Corona-Krise wird voraussichtlich die Nachfrage nach baulich-technischem Einbruchschutz erhöhen, aber gleichzeitig Investitionen durch Einkommensverluste erschweren.
Fokus Volkswirtschaft
Kommunale Investitionsrückstände können verschiedene Ursachen haben. Die zu Grunde liegenden Zusammenhänge können dabei sehr komplex sein. Deshalb werden in der Analyse erstmalig Daten der amtlichen Statistik mit den Ergebnissen des KfW-Kommunalpanels kombiniert und anhand von Methoden maschinellen Lernens analysiert. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass es hohe Rückstände sowohl in finanzstarken als auch finanzschwachen Regionen gibt, für die aber unterschiedliche Probleme ursächlich scheinen. Aus der reinen Höhe der Rückstände lässt sich somit noch keine politisch sinnvolle Maßnahme ableiten. Für einen Abbau des Rückstandes müssen deshalb nicht nur finanzielle Hürden sondern auch kapazitative Engpässe abgebaut werden.
Fokus Volkswirtschaft
Das allgemeine Zinsniveau verharrt auf einem niedrigen Niveau. Auf die kommunalen Investitionen hat dies unterschiedliche Effekte. Der Hoffnung, dass niedrige Zinsen die Investitionen vergünstigen und zu einem Abbau des kommunalen Investitionsstaus beitragen, stehen Befürchtungen entgegen, dass die Preissteigerungen im Bausektor die Investitionen eher ausbremsen. Es zeigt sich, dass die kommunale Ebene insgesamt überproportional von den Preissteigerungen betroffen ist und die Zinsentlastungen dies nicht kompensieren können. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass der kommunale Investitionsrückstand allein aufgrund der Niedrigzinsen spürbar abgebaut werden kann.
Das KfW-Kommunalpanel spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftspolitischen Debatte in Deutschland. Darum ist es wichtig, dass die Auswertung der Befragung wissenschaftlich belastbare Ergebnisse hervorbringt. Dieser Qualitätsanspruch wird vor allem durch die ausgefeilte Methodik gewährleistet, der sowohl die Erhebung als auch die Aufbereitung und Auswertung der Daten unterliegt. Im Methodenpapier erläutern die Autoren des KfW-Kommunalpanels das methodische Vorgehen von der Befragung bis zum Endbericht. Im Detail wird auch auf die Hochrechnung sowie die Gewichtung eingegangen, worauf wesentliche Ergebnisse beruhen. Die Diskussion der Stärken und Schwächen dieser Methoden lässt auch einen Ausblick auf die Aussagekraft der Ergebnisse zu. Das Methodenpapier hilft damit dem interessierten Leser, die Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels besser verstehen zu können.
Fokus Digitalisierung
Digitalisierung in Kommunen hat viele Facetten. In einigen Bereichen gibt es bereits beachtliche Fortschritte, in anderen zeigen sich noch erhebliche Nachholbedarfe. Dabei muss der Fokus zukünftig stärker auf den Bedürfnissen und Bedenken bei Bürgern und der Verwaltung liegen. Die zentralen Herausforderungen sind neben dem Ausbau der notwendigen Infrastruktur, insbesondere beim Breitbandinternet, deshalb die Anpassung von Verwaltungsprozesse und der Ausbau des E-Governments. Nicht zuletzt müssen zentrale Fragen wie Datenschutz und Datenzugang geklärt werden. Dafür bedarf es klarer Strategien, ausreichender Ressourcen und einer hohen Priorität des Themas in Politik und Verwaltung. Digitalisierung ist für Kommunen somit leichter gesagt als tatsächlich umgesetzt.
Digitalisierung in Kommunen: leichter gesagt als getan(PDF, 217 KB, nicht barrierefrei)
Fokus Volkswirtschaft
Die Organisation in den deutschen Kommunen ist von einer spannenden Vielfalt geprägt. Viele Aufgaben werden nicht in der Kernverwaltung, sondern in ausgelagerten Betrieben und eigenständigen Unternehmen wahrgenommen. Dies spiegelt sich auch in zahlreichen Kennzahlen wider und muss bei der Interpretation berücksichtigt werden. So fallen beispielsweise viele der nötigen Investitionen für die Energie- oder Verkehrswende eher in den ausgelagerten Stadtwerken an. Großstädte nutzen dabei häufiger Auslagerungen; hier versteckt sich hinter den Beteiligungen regelrecht eine "zweite Stadt". Im KfW-Kommunalpanel finden sich informative Angaben zu den ausgelagerten Aufgabenbereichen, die in dieser Form nicht in den amtlichen Statistiken zu finden sind.
Fokus Volkswirtschaft
Im KfW-Kommunalpanel 2019 beziffern die Kommunen ihren wahrgenommenen Investitionsrückstand bei Schulen auf 42,8 Mrd. EUR. Dies ist immer noch ein hohes Niveau, obwohl sich das Investitionsdefizit im Vergleich zum Vorjahr verringert hat. Die Ursachen unterscheiden sich zwischen den Kommunen. In finanzschwachen Regionen werden eher strukturelle Gründe wie eine grundsätzlich unzureichende Finanzausstattung genannt. In finanzstarken Regionen fallen eher temporäre Faktoren wie Kapazitätsengpässe in der Verwaltung und Bauwirtschaft stärker ins Gewicht. Zur Lösung des kommunalen Investitionsproblems müssen solche unterschiedlichen Muster berücksichtigt werden.
Volle Kassen verschaffen Atempause, Blick in die Zukunft trübt sich aber ein
Die Mehrheit der Kommunen berichtet im KfW-Kommunalpanel 2019 von einer guten oder sogar sehr guten Haushaltslage. Viele Investitionsprojekte konnten geplant oder sogar begonnen werden, sodass der wahrgenommene Investitionsrückstand laut bundesweiter Hochrechnung auf rd. 138 Mrd. EUR sinkt und in etwa wieder das Niveau des Jahres 2015 erreicht. Die befragten Kämmereien sehen jedoch deutlich skeptischer auf die zukünftige Finanzlage. Auch lässt sich ca. ein Drittel der Investitionen nicht wie geplant realisieren. Es bleibt also abzuwarten, ob der Abbau des Investitionsrückstands fortgesetzt werden kann. Das KfW-Kommunalpanel basiert auf einer vom Deutschen Institut für Urbanistik jährlich durchgeführten bundesweiten repräsentativen Befragung der kommunalen Finanzentscheider in den Städten, Gemeinden und Landkreisen und gilt als wichtige Referenzgröße in der wirtschaftspolitischen Debatte in Deutschland.
Fokus Volkswirtschaft
Der Investitionsrückstand bei der öffentlichen Infrastruktur ist immer wieder Gegenstand der Debatte in Politik und Wissenschaft. Bei der Erfassung dieser Größe können entweder amtliche Statistiken oder Expertenbefragungen herangezogen werden. Beide Ansätze haben spezifische Stärken und Schwächen. Den höchsten Erkenntnisgewinn verspricht deshalb eine Kombination beider Ansätze.
Evaluation des KfW-Förderprogramms 432 für die Förderjahrgänge 2011–2017
Um Synergien von energetischen Investitionsmaßnahmen in einem ganzen Stadtquartier zu heben, fördert die KfW mit Mitteln des BMI im Programm 432 über einen Zuschuss an die Kommunen das Erstellen eines integrierten Quartierskonzepts sowie dessen Umsetzung mit einem Sanierungsmanagement. Die Evaluierung des Programms durch die unabhängige Prognos AG zeigt, dass damit Klimaschutz und Treibhausgasreduktion auf Stadtteilebene Erfolg versprechend gefördert werden kann.
Fokus Volkswirtschaft
Der notwendige Klima- und Umweltschutz erfordert auch in den deutschen Kommunen große Investitionen in die Infrastruktur. Schon jetzt beklagen die Kommunen einen beachtlichen Investitionsrückstand und es ist nicht klar, wie die erforderlichen Investitionen zur Steigerung der Nachhaltig finanziert werden können. Green Bonds wurden als Finanzierungsinstrument für diese Herausforderung entwickelt, sind aber in deutschen Kommunen noch nahezu unbekannt. Wenn sich das ändern soll, müssen erst verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden.
Weitere Informationen zu grüne Finanzierung kommunaler Investitionen



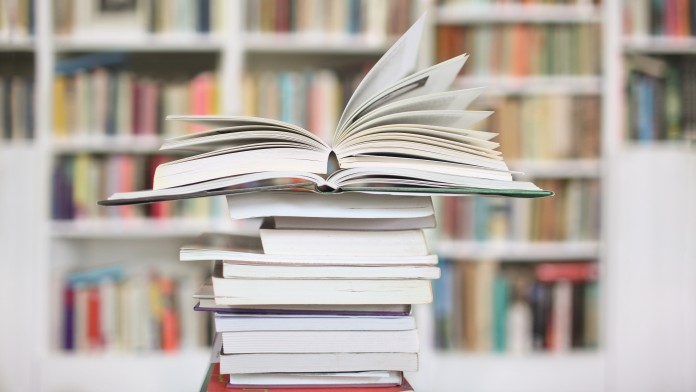
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw.de/s/dekBbrjd
Link kopieren Link kopiert