Solingen hat seine Bekanntheit dem 800 Jahre alten Klingenhandwerk zu verdanken. Jetzt will die nordrhein-westfälische Kommune auch in der Datenwelt Vorbild sein.

Dirk Wagner, Leiter der Verwaltungssteuerung im Rathaus (links), und Nils Gerken, Chief Information Officer, präsentieren Solingens erste digitale Stele. Mit Säulen wie dieser will die Kommune in der Innenstadt testen, welche digitalen Informationen und Angebote die Bürgerinnen und Bürger bevorzugen.
„Wir arbeiten mit Prototypen“, sagt Dirk Wagner. Bürgerinnen und Bürger können sie sich anschauen und sagen, was sie davon halten. Der Prototyp wird öffentlich begutachtet und in diesem Prozess womöglich verändert, bevor er in Serie geht. So beschreibt Wagner, Leiter der Verwaltungssteuerung im Rathaus der Stadt Solingen und dort zuständig für das Projekt „Smart City“, wie die Stadt aus dem Bergischen Land die Digitalisierung im Dialog mit der Bevölkerung voranbringt.
Die digitale Stele ist so ein Prototyp. Die mannshohe Infowand zeigt Daten an: Temperatur etwa, Windstärke, UV-Index, auch Nachrichten aus dem Rathaus. Sie dient überdies als WLAN-Hotspot. Die größte Fläche nimmt ein Stadtplan ein, auf dem man sich per Touchscreen orientieren kann. Informatiker der Kommune haben die Stele zusammen mit einem Start-up entworfen. Drei davon werden Anfang 2020 in der Stadt aufgestellt. „Prototypen kann man anfassen“, sagt Nils Gerken, Chief Information Officer (CIO) der Verwaltung und an der Entwicklung der Stele beteiligt, „sie geben eine Vorstellung davon, was gemeint ist.“ Das sei besser, als rein über Strategie zu reden.

Ein Behördenservice gehört ebenso zur kommunalen App „Mensch, Solingen!“ wie kulturelle und touristische Informationen.
Digitale Strahlkraft in der „Klingenstadt“
Ein grundsätzliches Digitalisierungskonzept hat Solingen schon. Deshalb kann die Kommune die Förderung, die sie als einer der ersten 13 Gewinner der Ausschreibung „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) bekommt, gleich in konkrete Projekte ummünzen. Neun Millionen Euro Zuschuss gibt die KfW im Auftrag des Bundes der Stadt, eine Million muss die Kommune aus eigenen Mitteln drauflegen. Solingen ist mit 160.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die derzeit größte der vom BMI und der KfW geförderten Smart Cities. Bislang waren es allein die Schneidwaren- und die Besteckindustrie, die Solingen zu überregionaler Bekanntheit führten und ihr den Beinamen „Klingenstadt“ einbrachten. Einen Anteil von mehr als 20 Prozent hat die 800 Jahre alte Branche immer noch am produzierenden Gewerbe Solingens. Nun will die Stadt auch in der digitalen Welt Strahlkraft entwickeln.
„Die Zukunft gehört den Städten, die die Digitalisierung aller Lebensbereiche aktiv nutzen, um Mehrwerte für die Bürger zu schaffen“, sagt Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Seit seinem Amtsantritt 2015 forciert er den technologischen Wandel. Schon vor seiner Zeit hatte die Stadt begonnen, auf eigene Kosten Glasfaser zu verlegen. Heute ist das Hochgeschwindigkeitsnetz mehr als 300 Kilometer lang. Alle Gewerbegebiete sind an die Datenautobahn angeschlossen, ebenso alle 55 Schulstandorte.
Lesen Sie unter der Bildergalerie weiter.
Einen Bauwagen hat die Stadt zur mobilen Beratungsstelle umbauen lassen. Mit ihr informiert sie auch über den digitalen Wandel. Ihn zu gestalten gehört zum Aufgabengebiet von Dirk Wagner (links), IT-Spezialistin Simone Nakaten, und Nils Gerken.
Der Befürchtung, dass die angestrebte Digitalisierung der Verwaltungsprozesse und der Dienstleistungen für Bürger viele Rathausmitarbeiter den Job kosten könnte, begegnet Wagner mit einer erstaunlichen Vorausschau: „Von den 3.000 Menschen, die die Stadt momentan beschäftigt, wird in den kommenden Jahren etwa die Hälfte in den Ruhestand gehen.“
In der täglichen Arbeit des Lokalparlaments ist die Digitalisierung bereits angekommen: Alles, was ein Solinger Ratsmitglied für seine Sitzungen braucht, ist ein Tablet und ein digitaler Stift, die die Stadt ihm zur Verfügung stellt. Alle relevanten Berichte, Anträge, Vorlagen gibt es in einer einfach zu bedienenden App. Doch das Digitalisierungslabor liegt keineswegs im Rathaus, sondern mitten in der Innenstadt. Nach einem kurzen Gang durchs Solinger Zentrum versteht der Ortsfremde, warum: Der Ladenleerstand ist unübersehbar. „Die Struktur hat sich gewandelt“, sagt Wagner. Es gebe zu wenige Wohnungen, aber zu viel Einzelhandel. Die Stadt möchte das Viertel auch für Menschen mit mehr Kaufkraft attraktiver gestalten.
Prototypen für digitale Projekte
In der Solinger Mitte soll exemplarisch gezeigt werden, wie sich städtische Räume auch mit digitalen Mitteln entwickeln lassen. Bürgerbeteiligung wird über eine Begegnungsstätte organisiert, die die Kommune demnächst im Zentrum einrichtet. Oder auch mit dem umgebauten Bauwagen, den die Stadtverwaltung schon jetzt für Informationsveranstaltungen vor Ort nutzt. „Auch wir haben gelernt, dass digitale Bürgerbeteiligung allein nicht funktioniert“, sagt Gerken, „man muss zu den Bürgern gehen.“
Welche Prototypen also bekommen die Solingerinnen und Solinger demnächst zu sehen? Die Infostelen natürlich. Mülleimer, die der Müllabfuhr per Sensor ihren Füllstand übermitteln. Abgeholt wird der Abfall, wenn der Behälter voll ist. Oder intelligente LED-Straßenlaternen, deren Lichtstärke sich dem Verkehrsaufkommen anpasst. Auf 80 Prozent beziffert Wagner das Energieeinsparpotenzial solcher Leuchtmasten. So wie sich die Kommune in diesem Fall technisches Know-how von der TU Berlin holt, so arbeitet sie auch auf anderen Feldern des digitalen Wandels mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten zusammen.
Auf dem Gebiet der Mobilität beschäftigt sich Solingen mit der Parkraumorganisation, die ja zugleich Verkehrssteuerung ist. Mit einigen Sensoren in einer Straße am Rathaus hat es begonnen. Aber, so fragen sie sich inzwischen, braucht man überhaupt so viele in der Straße verbaute Sender? Reichen auf einem großen Parkplatz nicht wenige Kameras in Verbindung mit einer Software, die die Zahl der freien Plätze kalkuliert? Eine solche Lösung wolle man sich mal anschauen, sagt Wagner.

E-Busse fahren in Solingen schon seit bald 70 Jahren. Die Stadt ist eine von nur noch dreien in Deutschland, die im öffentlichen Nahverkehr am einst weitverbreiteten Oberleitungsbus festgehalten haben.
E-Busse mit Ökostrom
Die Förderung von BMI und KfW ermöglicht der Stadt, Projekte wie diese zu verfolgen, für die sie sonst kaum die Mittel hätte. Solingen gehört, wie auch andere ausgezeichnete Smart Cities, zu den überschuldeten Städten in Haushaltssicherung, was besagt, dass die Kommune einen ausgeglichenen Etat vorlegen und genehmigen lassen muss. Auch deshalb ist es nach den Worten Wagners wichtig, nur solche Projekte anzustoßen, die sich die Stadt nach Auslaufen der in ihrem Falle vier Jahre währenden Förderung auch leisten kann.
Ohnehin legen BMI und KfW Wert darauf, dass die ausgewählten Kommunen übertragbare Modelle entwickeln. Wagner berichtet schon jetzt von einem „hohen Interesse“ an Solinger Ideen gerade von denjenigen Städten und Gemeinden, die nicht am Wettbewerb „Modellprojekte Smart Cities“ teilgenommen haben.
In der Rolle, etwas anders zu machen als andere, kennt sich Solingen aus. So fahren seit Jahrzehnten Oberleitungsbusse durch die Straßen. Man hat zwar zuletzt in den Neunzigerjahren über die Abschaffung dieses scheinbar anachronistischen öffentlichen Transportmittels diskutiert, heute jedoch kaufen Großstädte E-Busse, um Dieselfahrverbote zu vermeiden.
Quelle

Der Artikel ist erschienen in CHANCEN Kompakt Frühjahr/Sommer 2020 „Digitale Pioniere".
Zur AusgabeDie Hälfte aller Solinger Stadtbusse hängt an der Oberleitung und nutzt Ökostrom. Zu weit entfernten Haltestellen, die ans Stromnetz anzuschließen unrentabel wäre, kommen die O-Busse aber bisher mit Diesel. Seit Ende Oktober 2019 nun fahren sogar Batterie-Oberleitungsbusse (BOBs) durch die Stadt im Bergischen Land. Die Wagen der Linie 695 nach Gräfrath laden ihre Akkus über Schnellladestationen und die Oberleitung und sind, wenn diese endet, mit Batterie unterwegs.
Über die Modellphase ist der BOB hinaus. Mehr als ein Dutzend Busse dieses Typs sind nach den Worten Wagners bestellt. Wann und wo sie fahren, verrät bald die städtische App „Mensch, Solingen!“. Die gibt es bisher erst in einer Betaversion. Bürgerinnen und Bürger testen derzeit den Prototyp.
Zu diesen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leistet das dargestellte Projekt einen Beitrag
Ziel 9: Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung
Eine nicht vorhandene oder marode Infrastruktur hemmt die Wirtschaftlichkeit und fördert so die Armut. Beim Aufbau der Infrastruktur sollte der Aspekt der Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, zum Beispiel mit der Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Auch Fabriken und Industriestätten sollten nach ökologischen Gesichtspunkten nachhaltig produzieren, um eine unnötige Umweltbelastung zu vermeiden. Quelle: www.17ziele.de

Alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedeten im Jahr 2015 die Agenda 2030. Ihr Herzstück ist ein Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, den Sustainable Development Goals (SDGs). Unsere Welt soll sich in einen Ort verwandeln, an dem Menschen ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig in Frieden miteinander leben können.
Auf KfW Stories veröffentlicht am 14. Januar 2020

















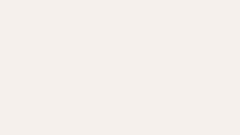







Datenschutzgrundsätze
Wenn Sie auf eines der Icons der hier aufgeführten klicken, werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise